Letztes Corona-Update: Resilienz 2022+
Wer hat noch Lust auf mehr oder weniger kluge Beiträge über Corona / Covid19? Ich auch nicht. Fast ein Jahr ist es nun her, dass ich mit meinem Pandemie-Beitrag einige Gemüter erhitzt habe. Am 28. Feburar 2021 veröffentlichte ich meine Gedanken darüber, wie wohl der Corona-Sommer 2021 verlaufen könnte und schrieb unter anderem in eine Zwischenüberschrift "Querdenker töten":
Und wo stehen wir jetzt?
Inzwischen ist der Plan der Durchseuchung der Gesellschaft mit Corona (v. a. Delta und Omikron) längst Realität, auch die neue Bundesregierung setzt der kollektiven Verwirrung wenig entgegen und meine Wünsche für beherzte Maßnahmen für mehr Bildung, Gerechtigkeit und Demokratie wirken inzwischen utopisch. Sind wir hier etwa nicht bei "wünsch dir was"? Natürlich nicht.
Dazu fällt mir ein Zitat des Schweizer Schriftstellers Kurt Marti ein:
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Kurt Marti, 1921-2017
Gerade erleben wir eindrucksvoll die Antwort auf diese geniale rhetorische Frage.
Resilienz nach Corona
Die kollektive Krisenerfahrung, die die Menschheit hätte zusammenschweißen können, hat eher zu einer Vertiefung der Gräben geführt. Auch global. Denn schaut man sich den Impfstatus der Staaten bei Statista an, bildet dieser natürlich die Verteilung des globalen Bruttoinlandsprodukts ab. Einerseits konsequent, andererseits weit entfernt von den ach so humanistischen Idealen der Weltgemeinschaft. Andererseits weisen nicht immer demokratische Staaten die höchste Impfquote auf, so führen die Vereinigten Arabischen Emirate die Tabelle an, auch in den Top 10: China und Kambodscha (Quelle: NZZ).
Derweil prallen Meinungen, Gruppen und sogar Staaten aufeinander wie lange nicht mehr. Inzwischen erleben wir die Neuauflage des Kalten Kriegs, der umso heißer wird, je leidenschaftlicher einzelne Menschen oder ganze Staatsregierungen auf ihrem Ego bestehen, anstatt die Argumente der Gegenseite anzuhören. Ob es um die Herkunft des Virus oder die Blockkonfrontation im europäischen Osten geht, die so hoch gelobte Individualisierung hat uns in einen Hobbes'schen Krisenzustand geführt, in dem wieder jeder Mensch des anderen Menschen Wolf ist. Wer nicht meine Ziele unterstützt, ist ganz klar mein Feind - so scheint das Credo vieler (insb. Social Media) Aktivisten.
Leider hat sich parallel der Zustand der Demokratie weltweit verschlechtert, wie die letzte Aktualisierung der berühmten Economist-Studie zeigte; nur noch etwa 45,7 Prozent der Weltbevölkerung lebt in einer Demokratie ggü. 49,4 Prozent im Jahr 2020. Anders als einige Trendforscher und andere Propheten hat sich also leider keine sprunghafte Verbesserung von praktisch allem durch die Pandemie ergeben. Schade.
Corona im Sommer 2022+
Wagen wir also eine (hoffentlich) letzte Prognose, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht. Die Grundbedingungen sind wenig rosig, doch es gibt natürlich auch Hoffnung. Zunächst die Sorgen.
Wir spazieren barfuß auf dem Scherbenhaufen, vielleicht unterlassen Verantwortliche deshalb ruckhafte oder große Schritte. Das Vertrauen in Politik und Medien hat seinen Tiefpunkt erreicht, was eigentlich ein Indiz dafür ist, dass sich "die Medien" oder "die Politik" eben nicht besonders gut absprechen (konträr zur Meinung eines großen Teils der "Systemkritiker"). Wer schon während der Bundestagswahl und den Koalitionsverhandlungen insbesondere gegen den rot-grünen Part der Ampel war, wird nun wenig Verständnis für jede Form der Politik haben. Es ist ja viel einfacher, sich weiterhin auf der eigenen Meinung auszuruhen und die eigene Dagegenheit zur Schau zu tragen, gern bei den grenzwertigen Spaziergängen.
Hoffnung habe ich in folgenden Dimensionen:
- Dank moderner Technologie, öffentlichem Interesse und großen Anstrengungen auf politischer und gesellschaftlicher Ebene ist es sehr schnell gelungen, wirksame Impfstoffe in Rekordzeit zu entwickeln. Ich bin kein bedingungsloser Fan sämtlicher Maßnahmen zur Eindämmung und Bekämpfung der Virusausbreitung. Im Großen und Ganzen jedoch geht aktuell leider auch schnell wieder unter, wie privilegiert wir im globalen Norden sind, überhaupt Zugang zu Hygiene und Gesundheitsversorgung im Allgemeinen, zu einer breiten Auswahl von Impfstoffen im Speziellen zu haben.
- Inzwischen ist empirisch recht gut belegt, dass die Mehrheit der Gesellschaft wenig mit Systemrevolte anfangen kann. Die offiziellen Querdenker-Kanäle sind inzwischen an sich selbst und der Realität zerbröselt, teilweise wurden sie aufgrund der klar systemfeindlichen und nicht selten rassistischen oder antisemitischen Kultur zensiert oder gar verboten. Wer jetzt auch noch den Mut hat, seinen Egotrip zu beenden und Fehler einzugestehen, sollte dafür Anerkennung erhalten. Amnestie für Querdenker!? Das Paradoxe: Inzwischen zieht es einen ordentlichen Teil der Systemopposition aus demselben Grund in die Normalität wie die demokratische Mehrheit - die Schlacht wurde verloren, einige zentrale Köpfe der Bewegung sind gefallen, also zurück zur scheinbaren Konformität.
- Apropos Köpfe: Die Pandemie hat viele kreative und innovative Köpfe zusammengebracht. Einige davon habe ich in meinem Podcast befragt. Ob Nachhaltigkeit, Bildung oder Digitalisierung - nicht alles stand in den letzten zwei Jahren still. Vieles ging in die richtige Richtung, wenn man etwas Mut zur Lücke hat, wird man als Optimist ein Leuchten am Ende des Tunnels sehen.
- Apropos Ende des Tunnels: Mit der Corona-Variante Omikron ist nicht zu spaßen. Nein, auch sie kann tödlich verlaufen, gestern (13.02.2021) sind 42 Menschen in Deutschland am Virus gestorben, aktuell heute wird voraussichtlich die Marke von 120.000 Corona-Toten überschritten (Quelle: RKI). Dennoch ist die Hospitalisierung und auch die Sterberate mit dem Rückgang von Delta ebenfalls gesunken. Aus Perspektive des Virus macht das sogar Sinn: möglichst viele Wirte infizieren, sie aber nicht töten, um anschließend weiterleben zu können. Das heißt für unsere Pandemie-Prognose folgendes: Die Zeichen stehen auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie. Juhu! Dass das nicht bedeutet, dass wir komplett durchatmen können, versteht sich von selbst. Endemie ist nicht gleich: ungefährlich.
Was ist jetzt zu tun für mehr Resilienz?
Aber was wäre dieses Zlog ohne ein paar Denkzettel für die nächsten Monate? Also los:
- Wie ich in meinen letzten Vorträgen zum Thema "Resilienz" gebetsmühlenartig wiederholt habe, ist es nicht damit getan, eine Krise durchzustehen. Klar, als erstes gehört zur Verarbeitung einer schlimmen, traumatischen Erfahrung das Zurechtfinden in der neuen Normalität. Also: Euphorie, Party, Freedom Day! Danach geht's aber an die Aufarbeitung. Nicht zurück zum alten Normal, das ist völliger Unsinn. Es gehört zu jeder vernünftigen Krise, dass das alte Normal mit ihr stirbt. Wer versucht, daran festzuhalten oder dahin zurückzukehren, wird wahnsinning. Ich kenne das unter der Erfahrung einer PTBS. Insofern wünsche ich mir von einer mündigen Zivilgesellschaft, dass sie sich spätestens 2023 an eine umfangreiche Aufarbeitung der Krise, ihrer Ursachen und einer Neugestaltung auf Systemebene setzt.
- Systemebene heißt nicht einfach nur "die Politik", die dank unklarer Kommunikation zu viele Flanken geboten hat, um sogar im Zentrum der Demokratie immer wieder Angriffe hinzunehmen. Die Liste ist zu lang für einen kurzen Beitrag. Systemebene heißt aber eben auch ein neues Selbstverständnis "der Wirtschaft", in dem es nicht mehr sanktioniert werden darf, wenn man sozial und/oder ökologisch wirtschaftet. Der Wandel hat begonnen, doch mit ausschließlich Selbstverpflichtungen wird er zu lange dauern. Wir müssen uns auch wagen, Kapitalismus neu zu denken und wer jetzt automatisch "Sozialist!" rufen möchte, sollte nochmal nachdenken. Das ist keineswegs gemeint, sondern eine verbesserte Neuauflage der sozialen Marktwirtschaft. Und ja, das lohnt sich auch oder insbesondere, wenn anderswo die Demokratie abnimmt.
- Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wie ich schon am 03.07.2021 in meinem Mini-Podcast "Kai for Future" berichtet hatte, warnte der Weltbiodiversitätsrat (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, kurz IPBES) Mitte 2020 davor, andere Viren zu unterschätzen, während die globale Aufmerksamkeit auf Sars-Cov-2 ruht. Wörtlich sagte ich dann:
Es wird geschätzt, dass 1,7 Millionen Viren mit Säugetier- oder Vogel-Wirten aktuell noch unentdeckt sind, von denen wiederum 631-827 Tausend das Potenzial haben, Menschen zu infizieren. Nochmal die Zahl: durchschnittlich 730.000 Erreger warten nur darauf, Menschen zu infizieren. Dazu gehören u.a. einige weitere Coronaviren, aber auch der alte Bekannte H5N1 - Vogelgrippe - und dessen Mutationen.
Kai Gondlach in "Kai for Future" am 3.7.2021
Auf der Website des IPBES findet man alle Daten dazu. Kurz: Wir kommen nicht umhin, die Ursachen der Pandemie gründlich aufzuarbeiten und strukturelle Faktoren zum Teil großzügig anzupassen. Wie früher beschrieben, gehören dazu teils drastische Maßnahmen, die weniger drastisch wären, wenn man früher agiert hätte. Stichwort: Zukunftsforschung.
Und dann? Aufbereitung letzte Pandemie, Vorbereitung auf die nächste
Um die Einstiegsfrage aufzugreifen: Wer hat Lust auf noch eine Pandemie?
Ich denke, niemand. Insofern bereiten Sie sich gern innerlich schon mal darauf vor, auch in den nächsten Jahren zum Teil erhebliche Veränderungen im Alltag wahrzunehmen. Die steigenden Energiepreise der letzten Wochen sind ein erstes Indiz dafür, ähnlich wird es mit einigen Lebensmitteln - vor allem weit gereisten und ökologisch wenig nachhaltigen, wie insbesondere Fleischwaren - ablaufen. Hinzu kommen immer weitere Varianten bzw. Mutationen des vorhandenen Virus. Komplexe Lieferketten werden sich umstellen, Produktion weiterhin regionaler stattfinden. Und da haben wir noch nicht über politische Ungewissheiten wie den "neuen" Block Russland-China gesprochen, der sicherlich einige Auswirkungen auf den "Westen" im Gepäck hat. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden.
Ich bleibe dabei: Zukunft ist eine Frage der Perspektive. Wenn wir uns eine gute Zukunft wünschen, müssen wir auch etwas dafür tun.
Photo by Joshua Rawson-Harris on Unsplash
Ausblick 2022: Corona, Ampel und High-Tech
2021 ist vorbei. Endlich, denken jetzt bestimmt viele. Was erwartet uns im neuen Jahr 2022? Eins ist sicher: Es wird nie wieder so wenige Veränderungen und Überraschungen geben wie im zurückliegenden Jahr. Mit diesem Beitrag möchte ich ein paar Rückblicke geben, vor allem soll es aber um den Ausblick auf 2022 gehen. Anschließend gibt's noch einen sehr persönlichen Rückblick auf ein außerordentlich turbulentes Jahr in meinem Leben.
Allgemeiner Rück- und Ausblick 2021/2022
Zu jedem Ausblick gehört auch ein kurzer Rückblick. Ich bemühe mich um Reduktion aufs Wesentliche, versprochen!
Die wichtigsten Themen im Schnelldurchlauf:
Pandemie: Wie geht's 2022 weiter?
Corona spaltet die Gesellschaft nicht, stattdessen sind die bestehenden Spaltungen offensichtlicher zutage getreten. Noch immer ziehen ungeimpfte Mobs teils mit Fackeln, teils mit Kindern als Schutzschilde [wie in Schweinfurt, siehe 1, 2, 3, 4, 5] durch die Dörfer und wollen gehört werden. Sie sind entweder esoterisch oder aus anderen Gründen kategorisch gegen Impfungen und glauben, ihr Immunsystem komme mit dem Virus klar; sie sind Neonazis oder andere politische Extreme bzw. Radikale und haben nur auf eine Gelegenheit gewartet, die Demokratie anzugreifen und Ungebildete hinter sich zu versammeln; sie sind Ungebildete und/oder digital Abgehängte, die nicht wissen, wie man eine wahre von einer gefälschten Information unterscheidet; schließlich die Ängstlichen, die entweder Angst vor Spritzen haben, Angst vor einem Genozid durch Bill Gates oder Angst vor einem Impfstoff, der schneller denn je entwickelt wurde.
Gegen die Spekulationen hilft Information. Das Paul-Ehrlich-Institut sammelt beispielsweise Nebenwirkungen und Impfschäden und "gibt die durchschnittliche Häufigkeit von anaphylaktischen Reaktionen nach der Verabreichung von derzeit in Deutschland zugelassenen Impfstoffen mit 0,4 bis 11,8 pro 1 Million Impfstoffdosen an" [RKI]. Natürlich gibt es auch noch die Schwerkranken, die sich nicht impfen lassen können, doch das sind verschwindend wenige - die meisten Bedenken hinsichtlich der eigenen Untauglichkeit für eine Impfung werden sehr transparent aufgeklärt und treffen nicht zu. Und selbst bei einer Allergie gegen einzelne Bestandteile eines Vakzins gibt es ja zum Glück inzwischen eine breite Auswahl, bald auch sogenannte Totimpfstoffe. Für eine Übersicht zur Impfung empfiehlt sich die Übersicht des RKI sowie das Impf-Dashboard der Bundesregierung.
Meine Beobachtung nach bald zwei Jahren Pandemie: Es wird noch immer zu viel auf eine laute Minderheit gehört, was eigentlich ein Anzeichen einer guten Demokratie in einer pluralistischen Gesellschaft ist, dennoch bleibt diese Minderheit bei Anklagen, wir lebten in einer Corona-Diktatur; es gibt übrigens eine gruselige Überschneidung in den Splittergruppen, die sich ebenso vor einer Öko-Diktatur fürchten oder seit Jahren eine linksgrünversiffte Verschwörung wittern. Oft werden die hinreichend begründeten Eingriffe ins öffentliche Leben durch die Pandemiemaßnahmen als unrechtmäßige Grundgesetzeinschränkungen überspitzt; dies wurde nun mehrfach von unterschiedlichen Gerichten widerlegt. Umgekehrt rechtfertigen viele Gegner:innen ihre "Meinungsfreiheit", wenn sie die Wirksamkeit der Impfungen, die Wahrhaftigkeit medialer Berichterstattung oder den Hergang der Pandemie anzweifeln; doch auch Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen. Um genau zu sein genau dort, wo sie bewusst Lügen oder Fake News verbreitet - in einem Artikel von Mitte 2020 sehr verständlich erläutert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die einzige Logik, die das Handeln und Kommunizieren in den Kommentarspalten in "Social Media" eint, ist die durch den kognitiven Bestätigungsfehler (confirmation bias) befeuerte rekursive Beweisführung - wer oder was anderer Meinung ist, ist offensichtlich ein:e Gegner:in. Das ist keine Polemik, sondern sorgsam beobachtete Alltagspraxis.
Wechseln wir mal die Perspektive.
Infolge der Shutdowns wurden einerseits viele Existenzen bedroht oder mussten aufgeben. Auf der anderen Seite hat die Bundesregierung 57 Milliarden Euro an Zuschüssen ausgezahlt, um genau dies zu verhindern, Kredite wurden in Höhe von 109 Milliarden Euro vergeben (Stand November 2021). Vor allem kleine und mittlere Unternehmen wurden in der "Überbrückungshilfe III" berücksichtigt und gerettet, wovon auch ich profitiert habe. Wer hier noch von einer Diktatur spricht, ist ein Fall für die geschlossene Abteilung oder sollte vielleicht mal ein längeres Praktikum in Belarus machen.
Wir leben im Schlaraffenland und keiner merkt's.
Doch Empörung über diejenigen, die leider durch das Raster fallen oder tragischerweise mit den Antragsformularen überfordert sind, verbreitet sich erheblich effizienter als Erfolgsmeldungen über gerettete Existenzen und Rekordkurzarbeitergeldsummen. Wenn ich mir die Diskussionen bei Facebook, Instagram, Tiktok und Linkedin ansehe, wird mir immer übler. Mein Ansatz ist es immer, die Beweggründe von Skeptiker:innen und Gegner:innen besser zu verstehen; manchmal muss ich mich sehr beherrschen, nicht zynisch zu werden. Oft klappt es aber ganz gut und auf respektvolles Zuhören folgen ehrliche Auseinandersetzungen. Es wäre ja auch zu einfach davon auszugehen, dass eine scheinbar einfache Lösung einfach so von 100% der Bevölkerung angenommen wird. Was oft fehlt, ist gewaltfreie, respektvolle und offene Kommunikation über die Bedürfnisse der Menschen. Vielleicht klappt's ja mit dem neuen Gesundheitsminister, der sich allerdings gerade bei skeptischen Menschen nicht gerade hoher Beliebtheit erfreut.
Wie geht's weiter?
Die Wahrscheinlichkeit für weitere Covid-Varianten ist relativ hoch. Auf Delta und Omikron werden global sicherlich noch einige weitere folgen, viele davon werden es nicht um die Welt schaffen und milder sein als die bisherigen. Im globalen Norden ist inzwischen ein großer Teil der Bevölkerung besser dagegen geschützt, vor allem dank der Impfungen inklusive Booster. Mein Mix besteht übrigens aus AstraZeneca, BionTech und Moderna, da ich von Beginn an auf Kreuzimpfungen gesetzt habe. Der globale Süden wiederum wartet noch auf Impfungen, wodurch das Virus weiter mutieren kann. Bedeutet: Die Fortschreibung des wirtschaftlichen Kolonialismus ist eine medizinische Notlage in zahlreichen Staaten in Afrika, Südamerika und Teilen Asiens. Während viele Menschen keinen Zugang zu vernünftiger Medizin haben, lehnen viele Deutsche die Impfung ab - diese Wohlstandsverwahrlosung widert mich an. Entsprechend unterstütze ich harte Maßnahmen gegen Menschen, die andere Menschen und damit die Gesellschaft auf egoistische Weise immer wieder bei Versammlungen in Gefahr bringen, die Falschmeldungen verbreiten und respektlos (besonders in "Social" Media) gegen alles hetzen, was nicht ihrer Meinung ist. Solidarität war nie wichtiger, doch die haben viele leider verlernt. Dank der Unentschlossenheit oder auch bewussten Opposition gegen Wissenschaft stecken wir noch viele Monate in der Pandemie, die auch im nächsten Winter Maßnahmen notwendig machen dürfte mit der Folge, dass die sich weiter radikalisierenden Covidioten auch mal zu schwererem Geschütz greifen werden. Der große Knall kommt noch und wie es sich für einen Rechtsstaat gehört, warten wir selbstverständlich ab, bis es eine Katastrophe gibt.
Das bringt mich zum nächsten Punkt.
Ampel-Regierung 2022
Die Deutschen haben gewählt und dabei kam erstmals eine Dreier-Koalition als Bundesregierung heraus (wenn man die CSU nicht als eigenständige Partei begreift, was sie ja auch nicht ist). Die sogenannte Ampel-Regierung aus Sozialdemokraten (SPD), Grünen und Freidemokraten (FDP) hat sich relativ schnell nach der Bundestagswahl gefunden und nach kurzen Sondierungsgesprächen und gar nicht mal übermäßig zähen Koalitionsverhandlungen auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Anfang Dezember wurde Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler gewählt und der Rest des Kabinetts kann anderswo besser nachgelesen werden. Natürlich habe ich darüber auch in meinem Podcast "Im Hier und Morgen" berichtet. Was wichtig ist: Nach 16 Jahren konservativ geführter Politik freue ich mich unabhängig von der politischen Färbung auf eine progressive Regierung - wir brauchen mehr Veränderung. Denn was die Merkel-Ära auszeichnet, ist einerseits eine herzlichere und gar nicht mal so CDU-typische Kanzlerschaft des "wir schaffen das". Andererseits hat die Politik der kleinen Schritte ehrlicherweise vor allem verwaltet, statt zu gestalten; am Vergangenen festgehalten, statt sich Neuem zu öffnen; die Wogen im Äußeren geglättet, statt eigene Werte zu vertreten. Besonders in der Energie-, Sozial- und Wirtschaftspolitik hat sie bestehende Ungerechtigkeiten und Anachronismen verhärtet, statt sie aufzulösen.
Die Ampel-Regierung versteht sich im Kontrast zur CDU-Ära als Koalition des Aufbruchs. Viele auch strittige Punkte zwischen den einzelnen Parteien wurden erstaunlich schnell und konstruktiv gelöst; das könnte daran liegen, dass die FDP einfach mal wieder mitregieren wollte und somit viele Aspekte abgenickt hat. Was viele erstaunt hat, ist der scheinbare Triumpf der Freidemokraten, die Leitung des Verkehrsministeriums erlangt zu haben; für mich ein kluger Schachzug der Grünen, die ja wissen, dass Verkehr zwar in der Außenwahrnehmung ein wichtiges Ökothema ist, in Wirklichkeit aber Industrie und Ernährung die Hauptemissionsursachen sind. Meine Highlights sind der deutliche Anstieg des Mindestlohns, Bürokratieabbau in der Verwaltung, Neuordnung der Subventionspolitik insbesondere im Landwirtschaftssektor, Kohleausstieg bis 2030 und verpflichtende energetische Gebäudesanierung zum selben Datum. Selbstständigkeit soll stärker gefördert werden, Bildung stärker unabhängig vom sozialen Hintergrund und vor allem digitaler, Renten steigen und vieles mehr. Wenn die kommenden vier Jahre vernünftig genutzt werden sollen, dürfte schon in 2022 vieles auf den Weg gebracht werden. Ich bin gespannt, wie sich die Union positionieren wird, wie häufig Abstimmungen gemeinsam mit der AfD oder der Linken geschehen müssen!
Die politische Landschaft muss sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Manche erwarten sogar das Aufbrechen der klassischen links-rechts-grün-Dimension, zumal über 40 zugelassene Parteien andere und teils nur partikulare Interessen vertreten - aber nicht im Parlament vertreten sind. Das Wahlrecht könnte eine Reform vertragen. Vielleicht schiebt die Ampel ja auch ein solches Vorhaben an? Wir werden sehen. Klar ist, dass die Welt komplexer und schneller geworden ist, seit die Bundesrepublik gegründet wurde. Das ist erstmal weder gut noch schlecht, jedoch muss man darauf reagieren, wahre Resilienz üben, Zukünftebildung (Futures Literacy) vorantreiben und Reibungen aushalten.
High-Tech-Trends in 2022
Kryptowährungen wie der Bitcoin , Ethereum und andere "Altcoins" werden weiter im Wert zunehmen. Das war seit deren Erfindung Ende der 2000er Jahre bislang konstant so und doch beäugen viele diese Entwicklung eher skeptisch. Gegen Ende des Jahres 2022 werden sich dann wieder alle, die immer noch keine haben, ärgern. Aber dann ist ja wieder ein Jahr rum und man weiß ja nicht, ob es sich jetzt denn nun noch lohnt. Ich wäre da skeptisch, die größten Kursgewinne dürften im Laufe des Jahres 2022 zu verbuchen sein, doch wenn eine kritische Masse "in krypto macht", ist es vorbei und langweilig. Alle Jahre wieder halt. Ein benachbartes Thema sind die Non-Fungible Tokens (NFT), die weiterhin die Digitalwelt erobern. Wer mit dem Begriff NFTs noch nichts anfangen kann und trotzdem etwas digital unterwegs ist, sollte sich damit mal beschäftigen. Bei Medium gibt’s einen netten Artikel, wie NFTs Netflix und Amazon Prime angreifen könnten.
Das Web 3.0 und das Metaversum sind im Anmarsch, werden aber zurecht von einigen Tech-Pionieren als vollkommen überschätzt dargestellt. Ich denke aber schon, dass in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr Menschen immer mehr Zeit in der virtuellen Zweitwelt verbringen könnten, dort Geschäfte treiben, Geld verdienen und ausgeben. Einige werden vielleicht ihre Wohnung überhaupt nicht mehr verlassen, soblad die VR-Headsets und Matrixsuits ihnen eine virtuelle Welt so gut vorkaugeln, dass sich das Aufstehen nicht mehr lohnt. Sie ernähren sich von Pulver oder direkt intravenös, sind im Prinzip wie Palliativpatienten gut umsorgt und doch abwesend. Auf der anderen Seite der Skala dezentralisiert sich die Plattformökonomie der letzten Jahre zunehmend. Direkterer Tauschhandel, freiere Informationsströme, demokratischere Strukturen schaffen so den Sprung aus der Schmuddelecke im Deep und Dark Web. Wäre es nicht schön, wenn die Strafverfolgungsbehörden auch den Sprung ins 21. Jahrhundert schaffen und Cyber-Kriminalität endlich wirksam bekämpfen würden? Aber das bleibt 2022 unter Garantie noch ein Wunschtraum. Allerdings wäre es eine relevante Erwartung eines FDP-geführten Justizministeriums, die sich ja so digital und modern gibt?
Klar, künstliche Intelligenz ist weiter auf dem Vormarsch. Das ist nichts Neues, durchdringt aber endlich stärker auch die deutschsprachige Wirtschaft und Gesellschaft. Öffentliche Verwaltung natürlich noch nicht so sehr. Der oben erwähnte Band "Arbeitswelt und KI 2030" möchte genau das ändern und es gibt zahlreiche andere Aktivitäten (ja, auch staatliche), die den zögernden Organisationen helfen möchten. Dass man vor der Technologie, die ihren Namen völlig zu Unrecht trägt, keine Angst haben braucht, beschreibe ich zum Beispiel in dem Beitrag über "German Angst" gemeinsam mit Dr. Michaela Regneri, den wir auch in einer Podcast-Episode kommentiert haben. Die Transformation geschieht aus Vogelperspektive natürlich auch von selbst, doch ohne Starthilfe wird es zum größten Massensterben von Unternehmen führen. Es scheint unausweichlich, dass aufgrund fehlender Digitalisierung, antiquierter Unternehmensorganisation und schlechter Vorbereitung auf Demografie und Klimawandel ein nennenswerter Teil der Unternehmen die 2020er Jahre nicht überleben wird.
Da haben wir noch nicht von Quantencomputern und deren Anwendungen gesprochen, immerhin hat die Fraunhofer-Gesellschaft ja nun Zugriff auf einen IBM-QC und die Bundesregierung fördert den Aufbau eines eigenen Geräts. Davon hat der Mittelstand in diesem Jahrzehnt zwar nichts mehr, doch einige Produkte und Lösungen werden zeitnah, vielleicht schon 2022, auf den Markt kommen, die nur noch auf Basis eines Quantencomputers errechnet, ver- oder entschlüsselt werden können. Noch weniger anwendungsnah klingt die Entwicklung der Xenobots, also Roboter mit lebendigen Zellen, die beispielsweise auf die Reinigung der Ozeane oder Entschlackung der menschlichen Blutbahnen programmiert werden können und dann "sterben".
Die aktuelle medizinische Revolution ist im Labor weitgehend abgeschlossen und wir profitieren ja schon in hohem Maße von den Vorzügen künstlicher Intelligenz und neuartiger Gentechnologie. So schnell hat es eine Innovation noch nie von der Forschung in die Praxis geschafft, aber irgendetwas Gutes muss Covid19 ja auch haben. Nächstes Jahr werden wir immer mehr Anwendungen auch in der Breite sehen, darunter vielleicht neue Individualtherapien für schwere Krebsfälle oder Diabetes; bessere Früherkennung von schweren Krankheiten in besonderen Arztpraxen und Kliniken; personalisierte Arzneimittel aus neuen Apotheken. Das muss natürlich auch erlaubt sein, ich frage meine Krankenkassen ja regelmäßig, wann sie mir auf Grundlage meiner Genomsequenzierungen individuelle Angebote macht - dauert nocht...
Im Energiesektor bahnt sich seit Längerem eine Renaissance der Kernkraft an. Einerseits sollen die Kraftwerde sehr viel kleiner sein, andererseits nicht nur auf Kernspaltung, sondern Kernfusion basieren. Als ich in der siebten Klasse einen Vortrag darüber hielt, tadelte mich mein Physiklehrer Herr Kruse, dass die Idee zwar nett klinge, aber für immer eine Vision bleibe. Hoffentlich kann ich mich nächstes Jahr bei ihm melden und widerlegen, denn vieles deutet darauf hin, dass 2021 die wichtigsten Durchbrüche erzielt wurden, um ein Plasma zu stabilisieren und in wenigen Jahren tatsächlich ähnlich wie in der Sonne nahezu endlos viel Energie zu erzeugen. Seit Google sich mit Bill Gates zusammengetan hat und viele Milliarden US-Dollar in die Technologie investiert, sehe ich alle Anzeichen auf eine Revolution der Energiebranche. Politisch heikel, technologisch aber vielleicht derdie letzte Bedingung für eine neue Stufe der Zivilisation.
Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Unter High-Tech oder Bleeding-Edge-Tech versteht jede:r etwas anderes. Vielleicht kommen hier fehlende Themen ja auch mal in meinem Podcast oder Newsletter; ich bin ja auch immer offen für Anfragen und Diskussionen.
Mein privater Rückblick auf 2021: Auf und Ab!
Für viele war 2021 ein Jahr der Turbulenzen, so auch für mich. Es begann mit einigen guten Vorsätzen, unter anderem wollte ich mich ernsthaft auf den großen Hamburg Triathlon - immerhin der größte seiner Art weltweit - vorbereiten. Also ging ich Anfang Januar noch häufiger als sonst joggen, was in einer recht winterlich-vermatschten Umgebung natürlich riskant ist. Und so dauerte es nicht lang, bis ich mir beim Training im Park beide Knie verletzte. Genauer gesagt, waren beide Menisken angerissen. Aua. Da aber zu der Zeit dank der Corona-Shutdowns ohnehin nicht viele Reisen angesetzt waren, konnte ich mich ganz gut zuhause kurieren.
Im Frühjahr entspannten sich die Covid-Inzidenzen wieder, was mir auch wieder mehr Reisetätigkeit bescherte. So war ich bei tollen Kunden unterwegs, sprach öfter als sonst über Resilienz und habe unter anderem der Filmindustrie vorgerechnet, wann schauspielerfreie Filmproduktionen machbar sein werden. Dabei kam mir auch eine eigene Idee für eine Science-Fiction-Produktion, welche seitdem verfolgt wird - ist aber noch nicht spruchreif.
Nach ein paar Wochen Schonung und neuen Einlagen in den Schuhen habe ich mich dann auf das Fahrrad- und bald auch Schwimmtraining konzentriert. Schwimmen lief in der Leipziger Seenlandschaft problemlos, doch der nächste große Rückschlag geschah im Juli beim Radeln. Ich war gerade im meinem RedBull-Rennrad (R.I.P.) rund um Leipzig unterwegs und fuhr wieder von Westen über Plagwitz in die Stadt, eine vertraute Strecke. Das dachte sich wohl auch eine Autofahrerin, die beim Abbiegen nicht so genau hinsah und mich beim Anfahren vom Sattel riss. Ich war einige Minuten bewusstlos und als ich wieder zu mir kam, war mein erster Reflex, meine Hände und Füße zu bewegen - erfolgreich! Erleichterung! Alles andere war erstmal sekundär. Alles andere war: Schlüsselbeinbruch, mehrere Rippenprellungen, Hämatome und Platzwunden, ein abgebrochener Zahn, ein eingerissenes Ohr und natürlich ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma. Und natürlich die Tatsache, dass der Traum vom Triathlon aus war. Zwei Wochen später wurde ich dann entgegen einer Ersteinschätzung doch operiert und bekam eine Titanplatte in die Schulter implantiert, die dort nun für zwei Jahre wohnen wird. Ziemlich unangenehm alles, aber hey: es hätte schlimmer kommen können.
Am 31. Juli war dann noch eine ganz besondere Frist: Die Abgabe des Manuskripts für den Band "Arbeitswelt und KI 2030", den ich gemeinsam mit Inka Knappertsbusch bei Springer herausgebe. Inzwischen ist das Buch, das 41 Beiträge von 78 renommierten Expert:innen aus Forschung und Wirtschaft enthält, auch verfügbar und kann beispielsweise bei Amazon oder Buch7 oder Springer direkt bestellt werden. Aber zurück zum Thema: meinen eigenen Beitrag für den Band sowie die letzten Korrekturen habe ich in einem Krankenhausbett im Leipziger Uniklinikum unter recht starken Schmerzen finalisiert - wenn das mal kein Einsatz mit Herzblut ist! Aber so ist das Leben der Selbstständigen eben. Wenn es eine Frist gibt, wird die auch ernst genommen!
Zwei Wochen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus stand dann wiederum ein lebensveränderndes Ereignis an: Am 13. August habe ich die Liebe meines Lebens geheiratet! Unser Standesamt kennen einige vielleicht aus dem Fernsehen, da dort die meisten Episoden von "Hochzeit auf den ersten Blick" ihr Finale erlebten. Wir kannten uns aber schon ein bisschen länger... Einen Tag danach konnten wir dann sogar mit all unseren Freunden und Verwandten in tollen Leipziger Locations feiern (>90% geimpft, alle getestet). Zwei Tage pure Glücksgefühle, auch wenn der Hochzeitstanz und die vielen Umarmungen der Wundheilung meiner Schulter nicht unbedingt zuträglich waren.
Schließlich endete das Jahr mit einer traurigen Wendung. Mein Vater ist Anfang September im Alter von 87 Jahren zum letzten Mal eingeschlafen. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich ihn immer genannt habe, wenn es um die Frage ging, wie ich zur Zukunftsforschung gekommen bin. Wir hatten ein sehr gutes Vater-Sohn-Verhältnis und er hat mich auch in den letzten Jahren immer noch geprägt. In einem Buch namens "Papa, erzähl mal", das ich ihm zum 80. Geburtstag geschenkt und mir ausgefüllt zurückgewünscht hatte, schrieb er:

Sein Leben war für einen Jahrgang 1934 äußerst abwechslungsreich und in der ersten Hälfte auch reiseintensiv. In der zweiten kamen dann Selbstständigkeit und mein Bruder und ich dazu sowie schließlich eine ruhige Rentenzeit. Sein Abschied kam nicht vollkommen unerwartet, ging jedoch insgesamt relativ schnell; besonders dankbar bin ich dafür, dass er sich noch von seinem engsten Kreis verabschieden konnte, bevor wir seine Asche in einem Friedwald in der Nähe meiner Geburtsstadt Itzehoe beisetzen konnten.
Fazit: Alles anders, alles gleich
Auch das neue Jahr 2022 wird sich vor allem dadurch auszeichnen, dass vieles anders wird als erwartet. Als Zukunftsforscher kenne ich natürlich viele Entwicklungspfade, sonst bräuchte es ja keine Zukunftsforschung und Foresight. Als ursprünglicher Soziologe und Politik-/Verwaltungswissenschafler habe ich jedoch auch immer die Gesellschaft im Ganzen im Blick und stelle immer wieder fest, wie groß die Entfernung der Pioniere zu der stillen Masse ist. Es sollte nicht jede:r potenziell Raketenwissenschaftler:in werden können, doch ein Verständnis der wesentlichen Grundlagen der moderenen Gesellschaft wäre wichtig. Nur so begreifen Menschen Komplexität und Unplanbarkeit, nur so können sie echte von falschen Informationen unterscheiden, nur so ein zufriedenes und mündiges Leben führen. I have a dream...
Was sich ändert: Es stehen einige technologische Durchbrüche vor dem Beginn ihrer Kommerzialisierung; einige habe ich oben genannt. Worauf ich besonders gespannt bin, ist die Regionalisierung von Wertschöpfungsketten insbesondere in der Energiespeicher-/Batterieindustrie. Möglicherweise gelingt es Neuralink erstmals, Hirnimplantate für Menschen zum Einsatz zu bringen und einfache Gedanken an eine Maschine zu übertragen - der Startschuss für eine Wikipedia auf Gedankenabruf und damit die nächste Stufe des Transhumanismus. Es stehen fünf Landtagswahlen an: im (noch) Groko-Saarland, in (noch) Jamaika-Schleswig-Holstein, in (noch) schwarz-gelb-NRW und (noch) Groko-Niedersachsen. Wenn der Green New Deal ernsthaft umgesetzt wird, werden das Verbraucher:innen und Unternehmen deutlich zu spüren bekommen, nicht zuletzt durch die bereits begonnenen Umwälzungen an den internationalen Finanzmärkten in Richtung post-fossil. Dieser Drahtseilakt wird freilich nicht ohne Turbulenzen ablaufen, stellen Sie sich schon mal auf einen bunten Blumenstrauß von Wild Cards ein.
Was gleich bleibt: Wir leben in einer stabilen Demokratie, können uns auf die wesentlichen Pfeiler der Gesellschaft verlassen. Es droht weder der Zusammenbruch des Parlaments nach Weimarer Vorbild noch eine furchtbare Revolution der Querdenker. Die Preise steigen in fast allen Konsumbereichen und auf dem Weltmarkt, möglicherweise platzt die Immobilienblase nächstes Jahr, und klar, die Weltmächte sortieren sich gerade neu. Der Digitalisierungsschub durch die Pandemie wird anhalten und Automatisierung auch in akademische Berufe vordringen; es bleibt uns auch nichts anders übrig, da wir zu wenig Fachkräfte haben. Die Schwerkraft bleibt uns erhalten, die Klimakrise spitzt sich weiter zu und wir werden nicht müde, auf Risiken und Chancen hinzuweisen.
Doch was auf jeden Fall bleibt: Ich werde berichten, kommentieren und optimistisch nach vorn schauen. Irgendwer muss den Job ja erledigen.
In diesem Sinne wünsche ich allen, die das hier gelesen haben, einen gesunden, erfolgreichen und glücklichen Start in ein aufregendes, weltoffenes neues Jahr!
Disclaimer
Dieser Beitrag ist eine gekürzte und alternative, aber verwandte Fassung des Linkedin-Artikels "2021/2022: Rück- und Ausblick vom Zukunftsforscher" und erscheint in ähnlicher Form als Episode am 30. Dezember 2021 in meinem Podcast "Im Hier und Morgen".
Happy World Futures Day!
Der 2. Dezember wurde kürzlich von der UNESCO als "World Futures Day" (Weltzukünftetag) deklariert. Das ist heute. Also: Alles Gute zum Weltzukünftetag!
Warum Zukünfte?
Wir Menschen sind nach wie vor Säugetiere und zu einem hohen Grad durch unsere Biologie bestimmt, was auch gut ist. Doch in einer immer globaleren und vernetzteren Welt, die zu einem nennenswerten Anteil durch das Handeln komplexer staatlicher und privatwirtschaftlicher Organisationen gestaltet wird, brauchen auch wir Menschen neue Fähigkeiten. Insbesondere in Zeiten multipler Krisen (ich bevorzuge den Begriff "Herausforderungen") wird offenkundig, was passiert, wenn Menschen allein gelassen werden. Sie fühlen sich ohnmächtig, bevormundet, unwichtig.
Das hat die UNESCO (die Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Vereinten Nationen) früh erkannt. Seit 2021 unterhält sie daher den dauerhaften Sitz für Zukünftebildung (Futures Literacy). Denn der Umgang mit Komplexität, mit potenziell gefälschten Informationen in den (Online-)Medien, mit möglichen Zukünften muss gelernt sein! Auch im deutschsprachigen Raum kommt diese Erkenntnis immer mehr an, so ist die Initiative ZUKÜNFTE emsig dabei, Personen und Organisationen für die Zukünfte zu sensibilisieren. Einen der Treiber dieser Entwicklung, Dr. Stefan Bergheim, hatte ich ja auch schon mal zu Gast in meinem Podcast "Im Hier und Morgen", gemeinsam mit Lena Tünkers.
Es ist noch viel zu tun auf dem Weg in eine wirklich mündige Gesellschaft. Aber im Grunde ist es gar nicht so schwer; einfach auch mal über den Tellerrand schauen, andere Quellen prüfen, mögliche Szenarien überlegen und sich nicht ausschließlich von den Pfaden der Vergangenheit leiten lassen.
Auf eine gute, gesunde und mündige Zukunft - oder besser viele Zukünfte ;-)
Armin Laschets antisemitische Vergangenheit?
Armin Laschet, Kanzlerkandidat der CDU bei der Bundestagswahl 2021, könnte konservativer sein, als allgemein bekannt ist. Um nicht zu sagen: Laschet fiel in der Vergangenheit durch antisemitisches und NS-verherrlichendes Gedankengut auf. Angesichts der langjährigen Regierungsbeteiligung der Union wundert es allerdings nicht, dass diese Vergangenheit ad acta gelegt scheint. Durch Zufall stieß ich Anfang September im offiziellen Wikipedia-Artikel über Armin Laschet auf eine Passage, die mich stutzig machte:
„1988 war Laschet als Redenschreiber im Team von Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) tätig, bis der wegen seiner Gedenkrede zu den Novemberpogromen 1938 zurücktreten musste.“[1]
Die Referenz leitete leider zur falschen Quelle, weshalb ich selbst Nachforschungen anstellte. Zwei Fragen haben mich dabei geleitet: Warum trat Jenninger zurück und welche Rolle spielte Laschet dabei?
Warum trat Jenninger zurück?
Am 10. November 1988 hielt Bundestagspräsident Philipp Jenninger eine Rede (Audio und Transkript vorhanden[2]) im Deutschen Bundestag in Bonn anlässlich des 50. Gedenktages der NS-Novemberpogrome (Beginn 09.11.1938, auch Reichspogrom- oder Kristallnacht genannt). Es gab bereits im Vorfeld einen Eklat, als neben sämtlichen Fraktionen selbst der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland keine Redezeit erhielt.[3] Armin Laschet, damals noch als Journalist tätig, arbeitete für Jenninger – dass das nicht in seinem offiziellen Lebenslauf der CDU[4] auftaucht, wundert nicht. Die Presse im Ruhrgebiet wiederum erwähnte den „Fauxpas“ 2010.[5] Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung wiederum nennt Laschets Rolle in der Sache, relativiert aber auch die Schwere der Entgleisungen.[6]
Zitate aus der Rede:
- „Die Juden in Deutschland und in aller Welt gedenken heute der Ereignisse vor 50 Jahren. Auch wir Deutschen erinnern uns an das, was sich vor einem halben Jahrhundert in unserem Land zutrug, …“
- „Die Jahre von 1933 bis 1938 sind selbst aus der distanzierten Rückschau und in Kenntnis des Folgenden noch heute ein Faszinosum insofern, als es in der Geschichte kaum eine Parallele zu dem politischen Triumphzug Hitlers während jener ersten Jahre gibt.“
- „Machte nicht Hitler wahr, was Wilhelm II. nur versprochen hatte, nämlich die Deutschen herrlichen Zeiten entgegenzuführen? War er nicht wirklich von der Vorsehung auserwählt, ein Führer, wie er einem Volk nur einmal in tausend Jahren geschenkt wird?“
- „Und was die Juden anging: Hatten sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt – so hieß es damals -, die ihnen nicht zukam? Mußten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Hatten sie es nicht vielleicht sogar verdient, in ihre Schranken gewiesen zu werden? Und vor allem: Entsprach die Propaganda – abgesehen von wilden, nicht ernstzunehmenden Übertreibungen – nicht doch in wesentlichen Punkten eigenen Mutmaßungen und Überzeugungen?“
Es gibt auch richtige und wichtige Bezichtigungen der Grausamkeit und Manie der Nazis. Doch das rückt die Auswüchse nicht ins Licht. Es handelt sich bei dieser Rede um eine eindeutig NS-verherrlichende und Holocaust-relativierende Rhetorik; und in diesem Sinne vollkommen unangemessene Rede eines deutschen Amts- und Würdenträgers. Viele Stellen lassen sich nicht anders als „rechtsextrem“ feststellen. Das habe ich mit einer Historikerin und NS-Expertin geklärt.
Folgerichtig trat Philipp Jenninger am nächsten Tag aufgrund der öffentlichen Reaktionen zurück.
Welche Rolle spielte Laschet bei der rechtsextremen Rede?
Armin Laschet hat 1988 für den damaligen Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger als einer der Redenschreiber gearbeitet. Welchen Anteil Laschet zur Rede beigesteuert hat, ist unklar. Klar ist, dass er deren Inhalt darauf wenig später verteidigte. Genauer: Er veröffentlichte wenig später gemeinsam mit seinem Schwiegervater und Verleger Heinz Malangré das Buch „Philipp Jenninger. Rede und Reaktion“ mit schwarz-rot-golden eingerahmtem Titel. Darin verteidigen sie die Rede, drücken ihr völliges Missverständnis über die öffentlichen Reaktionen aus und bekräftigen stattdessen, dass viele Bürger die Rede großartig fanden.
Es steht also außer Frage, dass zumindest vor 32 Jahren Armin Laschet, Kanzlerkandidat der CDU 2021, deutlich braun gefärbtes Gedankengut in sich trug.
Diese Episode ist im Wahlkampf 2021 noch nicht aufgetaucht, ich konnte keine Statements dazu finden, lediglich weitere Sekundärquellen. Meiner Ansicht nach ist diese dunkle Episode im Lebenslauf eines Kanzlerkandidaten eine wichtige Information für die Wähler:innen.
Referenzen (alle abgerufen am 11.09.2021)
[1] Seite „Armin Laschet“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 11. September 2021, 08:39 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Armin_Laschet&oldid=215493268
[2] Die gesamte Rede als Audio beim SWR: https://www.swr.de/swr2/wissen/archivradio/philipp-jenningers-rede-am-jahrestag-der-reichspogromnacht-1988-102.html und als Transkript: https://www.severint.net/2019/11/10/dokumentiert-philipp-jenningersrede-1988-zum-jahrestag-der-novemberpogrome/ - 21 Jahre später griff der WDR das Thema erneut auf: „Rede und Reaktion: Die verunglückten CDU-Worte zum 9. November“, 20.11.2019 https://blog.wdr.de/landtagsblog/rede-und-reaktion-die-verunglueckten-cdu-worte-zum-9-november/
[3] Bundeszentrale für politische Bildung: https://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/deutschlandarchiv/171555/ungluecklicher-staatsakt-philipp-jenningers-rede-zum-50-jahrestag-der-novemberpogrome-1938
[4] https://archiv.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/lebenslauf_laschet.pdf (Zugriff bei allen Links am 11.09.2021)
[5] Ruhrbarone: „Der Kandidat von morgen und eine Rede von gestern“, 05.07.2010 https://www.ruhrbarone.de/der-kandidat-von-morgen-und-eine-rede-von-gestern/13630
[6] Konrad-Adenauer-Stiftung: https://www.kas.de/de/web/geschichte-der-cdu/personen/biogramm-detail/-/content/armin-laschet-v1
Foto Armin Laschet: Von Olaf Kosinsky - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97943526
Globale Krisenlandschaften in der Zeitschrift für Zukunftsforschung
Sie ist die deutschsprachige Instanz für wissenschaftliche Zukunftsforschung: die Zeitschrift für Zukunftsforschung (ZZF). Seit Langem wollte ich einen Beitrag dafür schreiben, um den Draht zur akademischen Zukunftsforschung nicht zu verlieren. In der jüngsten Ausgabe ist es endlich soweit und meine Replik auf einen sehr spannenden Vortrag, den Lars Brozus beim Netzwerk Zukunftsforschung gehalten und dann zu einem Essay verschriftlicht hat, ist erschienen: es ging um "Globale Krisenlandschaften, die Zukunftsforschung und Entscheidungshilfen für die Politik", veröffentlicht in der ZZF Vol. 2021 (1), 2021. Weitere Repliken schrieben Prof. Dr. Dr. Axel Zweck, Prof. Dr. Heiko von der Gracht & Prof. Dr. Stefanie Kisgen und Dr. Christian Neuhaus. Der Tenor: kritische Zukunftsforschung ist zu selten in politischen und administrativen Gremien verankert, um ihre volle Wirkung zu entfalten.
Der Beitrag kann kostenlos hier gelesen werden: https://www.zeitschrift-zukunftsforschung.de/ - und die Zeitschrift ist auch darüber hinaus lesenswert. Teilen erwünscht ;-)
Photo by Robert Metz on Unsplash
Zukunftsbilder der Parteien zur Bundestagswahl 2021
Als Zukunftsforscher, Soziologe und Politikwissenschaftler sehe ich es als meine Pflicht an, über politische Großereignisse und deren potenzielle Folgen in der Zukunft zu berichten. Daher habe ich mich im August aufgemacht und mir insgesamt 22 Wahlprogramme der größten Parteien für die Bundestagswahl 2021 heruntergeladen und diese analysiert. Dabei entstand eine sehr umfangreiche, quantitative Textanalyse der häufigsten Begriffe der einzelnen Parteien. Und natürlich konnte ich es mir nicht nehmen lassen, auch die Zukunftsbilder der Parteien zu identifizieren.
Auf meinen Social Media-Kanälen (insb. Instagram, Twitter und Tiktok) kommen dazu derzeit täglich mehrere Videos, in meinen beiden Podcasts "Im Hier und Morgen" (Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music) und "Kai for Future #KFF" (Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music) laufen jeweils Sonderserien bis nach der Wahl (beide auch auf Youtube). Mein wichtigstes Ziel der Kampagne ist: Auf alle 47 wählbaren Parteien und deren Programme hinzuweisen - und natürlich alle Menschen anzuregen, sich die Programme der Parteien anzuschauen, die häufig über die Themen schreiben, die ihnen wichtig sind: Klimawandel, Digitalisierung, Familien, Migration und viele mehr.
Die Zukunftsbilder der 22 analysierten Parteien
Ich habe mir die Bundestagswahlprogramme folgender Parteien angeschaut; die Reihenfolge richtet sich dabei nach dem Bundeswahlleiter: CDU, SPD, AfD, FDP, Die Linke, Bündnis90/Die Grünen, CSU, FREIE WÄHLER, Die PARTEI, Tierschutzpartei, NPD, Piraten, ÖDP, V-Partei³, DiB (Demokratie in Bewegung), BP (Bayernpartei), MLPD, Gesundheitsforschung, MENSCHLICHE WELT, DKP, Die Grauen, Volt Deutschland.
 CDU (Christlich-Demokratische Union)
CDU (Christlich-Demokratische Union)
Die CDU propagiert in ihrem Wahlprogramm ein sicheres und stabiles Deutschland in einem harmonischen Europa. Die besondere Rolle der gesellschaftlichen Leistungsträger und Unternehmen wird hervorgehoben. Dem Klimawandel muss durch ökonomisch funktionierende Anreizsysteme begegnet werden. Digitale Technologien sind wichtig und werden durch ein Digitalministerium verwaltet.
 SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
Die SPD sieht Deutschlands zukünftige Rolle primär als faire Solidargemeinschaft, in der aber auch die Rolle der Unternehmen und europäischer Werte eine dominante Rolle einnimmt. Der Klimawandel ist mit sozial gerechten Anreiz- und Sanktionsregeln zu bekämpfen. Digitale Technologien sind wichtig.
 AfD (Alternative für Deutschland)
AfD (Alternative für Deutschland)
Die AfD beschreibt Deutschlands Zukunft primär mit deutschen Familien ohne Migrationshintergrund, die Europäische Union soll sich zu einem Bund souveräner Staaten transformieren. Klimawandel wird sich bald als linksideologische Fehlannahme entpuppen.
 FDP (Freie Demokratische Partei)
FDP (Freie Demokratische Partei)
Die FDP betont freiheitliche Bürgerrechte in einer sicheren und starken EU, gestützt auf erfolgreiche Unternehmen. Deutschland muss modernisiert und Digitalisierung vorangetrieben werden. Klimawandel wird mittels Innovation bekämpft, spielt aber insgesamt nur eine durchschnittliche Rolle.
 Die LINKE
Die LINKE
Das Zukunftsbild von Die LINKE behandelt vor allem die Chancengleichheit und Antidiskriminierung von „Minderheiten“. Besonders sticht der Pflegebereich hervor. Der Klimawandel muss mit sozial gerechten Mitteln bekämpft werden. Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wird entschieden abgelehnt.
 Bündnis90/Die Grünen
Bündnis90/Die Grünen
Die GRÜNEN stellen ambitionierte Klimaschutzpläne ins Zentrum ihres Zukunftsbilds, in dem aber auch eine stabile und sichere EU fest verankert ist. Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wird entschieden abgelehnt.
 CSU (Christlich-Soziale Union)
CSU (Christlich-Soziale Union)
Im Zukunftsbild der CSU dominiert der Klimaschutz als „urkonservatives Anliegen“, welches Hand in Hand mit Wirtschaftswachstum gedacht werden muss. Durch Steuerentlastungen für Unternehmen, Vermögen und klassische Familien soll die Gesellschaft gerechter werden.
 FREIE WÄHLER
FREIE WÄHLER
Freie Wähler sehen mündige, freie und gerechte Bürgerrechte und Regionen im Zentrum des Zukunftsbilds. Die EU wird transparenter und basisdemokratischer. Einwanderung ist nur als „qualifizierte Arbeitsmigration“ vorgesehen, während internationale, klimaschädliche Pfadabhängigkeiten durch regionale Wirtschaftskreisläufe beendet werden.
 Die PARTEI (Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative)
Die PARTEI (Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative)
Die PARTEI stellt Gerechtigkeit klar ins Zentrum der Programmatik, wozu auch außenpolitische Maßnahmen gegen Diktaturen zählen. Mit Humor und Sarkasmus werden sich die Probleme in Luft auflösen.
 Tierschutzpartei
Tierschutzpartei
Das Zukunftsbild der Tierschutzpartei sticht vor allem durch einen starken Fokus auf Bildung hervor. Sämtliche tierwohlbezogenen Bereiche werden radikal transformiert, um Tierwohl und Klimaschutz voranzutreiben. Ein Digitalministerium setzt die Digitalisierung um.
 NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands)
NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands)
Die NPD sieht in ihrem Zukunftsbild vor allem das deutsche Volk sowie dessen von außen und innen bedrohte Heimat. „Klassische“ Familienmodelle werden gegenüber anderen Ideen gefördert und Deutschlands Grenzen in der EU wieder weitgehend versiegelt.
 PIRATEN
PIRATEN
Die PIRATEN sehen für die Umsetzung digitaler Themen ein Digitalministerium in ihrem Zukunftsbild vor, bewegen sich ansonsten im Rahmen freiheitlich rechtlicher, humanistischer Werte. Der Klimawandel wird durch wenige, dafür sehr wirksame Maßnahmen bekämpft.
 ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)
ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)
Die ÖDP sieht den Klimaschutz und eine starke Unterstützung von Familien und älteren Menschen als essenziell an. In ihrem Zukunftsbild ist eine sehr ausgewogene, harmonische Gesellschaft beschrieben.
 V-Partei³ (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer)
V-Partei³ (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer)
Die V-Partei³ lässt kein klares Zukunftsbild erkennen, sondern möchte in der Gegenwart mit einigen Schnellmaßnahmen die großen Herausforderungen der Zeit angehen.
 DiB (Demokratie in Bewegung)
DiB (Demokratie in Bewegung)
Im Zukunftsbild von DiB dominiert die Gleichstellung aller Menschen unabhängig ihrer körperlichen oder biografischen Eigenschaften (LSBTQIA+). Die Politik und insbesondere Lobbyregister werden transparenter gestaltet, um in der Bevölkerung für mehr Gerechtigkeit (auch zwischen den Generationen) herzustellen.
 BP (Bayernpartei)
BP (Bayernpartei)
Die Bayernpartei sieht die strukturelle Bekämpfung von Pandemien als wichtigen Zukunftspfeiler an. Bessere Bildungschancen und höhere Renten begleiten diese eher gegenwartsbezogene Vision.
 MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands)
MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands)
Die MLPD sieht den Kampf gegen den Faschismus, Antisemitismus und Rassismus als dauerhafte Bedingung für friedliches Zusammenleben der Bürger. Ein internationaler, vereinigter Sozialismus dominiert das Zukunftsbild.
 Partei für Gesundheitsforschung
Partei für Gesundheitsforschung
Im Zukunftsbild der Gesundheitsforschungspartei werden altersbedingte Krankheiten schon bald der Vergangenheit angehören. Dies wird durch massive staatliche Investitionen avisiert, welche als Nebeneffekt allen Generationen Vorteile versprechen.
 MENSCHLICHE WELT
MENSCHLICHE WELT
Das Zukunftsbild der Partei MENSCHLICHE WELT wird geprägt von kostenloser Bildung, alternativmedizinischen Heilverfahren und „klassischen“ Familien. Ethische und spirituelle Praktiken sollen diese Werte auch mit Tier und Natur in Einklang bringen.
 DKP (Deutsche Kommunistische Partei)
DKP (Deutsche Kommunistische Partei)
Die DKP sieht auch in Zukunft den Kampf für die Arbeiterklasse und gegen Kapitalismus, Faschismus und Rassismus als fortdauernde Aufgabe. Im Ergebnis wird daraus im Zukunftsbild die Idealform des Kommunismus hervorgehen.
 Die Grauen
Die Grauen
Die Grauen erwarten eine Zukunft der friedlichen Gesellschaft aller Generationen mit hohen Renten, freier (Aus-)Bildung oder Studium sowie glücklichen Familien. Altersdiskriminierung ist grundgesetzlich verboten.
 Volt Deutschland
Volt Deutschland
Das Zukunftsbild von Volt Deutschland wird geprägt durch wissenschaftlich fundierte Klimaschutzpolitik in einem solidarischen Europa. Volt sieht ein Digitalministerium zentral für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und betont als einzige Partei die Relevanz künstlicher Intelligenz.
Hinweise zur Vorgehensweise und Methode
Ich habe mich bemüht, möglichst objektiv an die Parteiprogramme heranzugehen. Ich bin politisch unabhängig und gestehe ehrlich, dass ich auch aus eigener Motivation diese Analyse begonnen habe, weil ich selbst unsicher war, wen ich wählen werde. Dabei hat mir die Analyse sehr geholfen, weshalb ich sie hier und andernorts veröffentliche. Wir leben in einer Zeit der multiplen Herausforderungen, in der altbewährte, oft ideologisch getriebene Parteiprogramme nicht mehr passen. Daher war ich auch selbst neugierig, wie die Parteien mit den Krisen der Zeit umgehen werden.
Transparenzhinweis: Meine eigene politische Gesinnung ist auf dem links-rechts-Spektrum tendenziell eher links der Mitte zu verorten, ich bin kein Mitglied einer Partei oder anderen politischen Gruppierung. Ich sehe mich als Populärwissenschafler den Gütekriterien wissenschaftlicher Arbeit verpflichtet. Inhaltlich liegen mir die Themen Digitalisierung, Bildung und Klima am Herzen, ich bin bekennender Pro-Europäer und Humanist. Während des Studiums war ich Mitglied der Grün-Alternativen-Liste (GAL) an der Universität Potsdam und als dieser auch Mitglied des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA - anderswo oft Studierendenrat, die Exekutive des Studierendenparlaments).
Zur methodischen Vorgehensweise: Ich bin kein Politikberatungs- oder -analyseinstitut. Ich bin ein freiberuflicher Zukunftsforscher und habe begrenzte Kapazitäten. Daher sind auch nicht sämtliche Parteiprogramme in die Analyse geflossen und natürlich auch nicht alle Begriffe und Konzepte, die relevant für die Menschen sein könnten. Dennoch habe ich versucht, auch die Begriffe anderer politischer Bewegungen als meiner eigenen Überzeugung zu berücksichtigen. Möglicherweise sind aufgrund der "einfachen" Analyse einige Begriffe häufiger oder seltener gezählt worden, als tatsächlich vorhanden. Bei vielen Begriffen habe ich jedoch auch eine Extrarunde gedreht, wie das Beispiel "Rente" zeigt: Der Begriff allein kann alleinstehend, aber auch als Wortteil auftauchen (z. B. "transpaRENTEN"), darüber hinaus habe ich natürlich auch nach den Begriffen "Alterssicherung", "Altersvorsorge" etc. gesucht. In einer sozialwissenschaftlich anspruchsvolleren Untersuchung hätte man außerdem nicht einfache Durchschnittswerte gebildet, sondern noch Quartile gebildet, um den Einfluss monothematischer Parteien auf den Durchschnitt zu relativieren. Natürlich gibt es Parteien, die sich primär um Tierschutz, Ernährung oder Gesundheit kümmern und daher beispielsweise keine Position zur NATO formulieren. Schließlich habe ich zunächst 21 Parteiprogramme analysiert und auf mehrfache Rückfrage noch Volt Deutschland in die Analyse einbezogen, welche aber keinen Einfluss mehr auf die Durchschnittswerte hatte und als Sonderzugang mit einer Wildcard zu betrachten ist.
Die Excel-Dateien zur Textanalyse können natürlich bei mir angefordert werden, dazu bitte einfach das Kontaktformular nutzen.
Bildrechte
Beitragsbild: Photo by Element5 Digital on Unsplash
Die Urheberrechte der Parteilogos liegen bei den Parteien selbst und dienen hier nur der Visualisierung. Um einen klaren Bezug herzustellen, sind sie mit den jeweiligen Websites verlinkt.
Gigatrend: Die Mutter der Megatrends
Was ist ein Gigatrend? Wer sich mit Zukunft beschäftigt, kennt das Konzept der Megatrends: Globalisierung, Female Shift, Konnektivität, Urbanisierung, Individualisierung, New Work und einige mehr. John Naisbitt hat das Konzept vor gut 40 Jahren entwickelt und damit der Zukunfts- und Trendforschung in weiten Teilen der westlichen Welt zu großem Ansehen verholfen. Megatrends sind Entwicklungen, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken und mehrere Gesellschaftsbereiche (Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt etc.) über einen längeren Zeitraum beeinflussen. Wobei: beeinflussen? Das ist sprachlich nicht ganz korrekt, natürlich sind es einzelne Treiber wie Unternehmen, (politische) Entscheidungsträger oder zivilgesellschaftliche Gruppen, die den Unterschied machen.
Megatrends gehören zu diesen Konstrukten, die sich wahnsinnig gut dazu eignen, Wandel sichtbar und vor allem kommunizierbar zu machen. Und doch greifen sie meiner Beobachtung nach zu kurz, wenn wir den Blick etwas weiten wollen. Sie wissen schon, Zukunft ist eine Frage der Perspektive - und ich möchte Sie hiermit einmal mehr einladen, Ihre Perspektive zu weiten. Denn in meinen Studien der letzten Jahre ist mir immer mehr aufgefallen, dass es noch größere Muster gibt, die sich über mehrere Jahrhunderte erstrecken.
Megatrends wirken jahrzehnte-, Gigatrends jahrhundertelang
Während sich die junge Disziplin der Zukunftsforschung schwer tut, Trends und Megatrends zu operationalisieren, habe ich nach größeren Mustern gesucht. Wozu? Die Antwort liegt im Zeitgeist. Das aktuelle Jahrzehnt ist schon jetzt ein Jahrzehnt der Superlative. Ein paar Beispiele:
- Die Klimakrise ist die größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte.
- Künstliche Intelligenz könnte in diesem Jahrzehnt die Singularität erreichen - Millionen Arbeitsplätze sind von der "Automatisierung" bedroht.
- Quantencomputer stehen kurz vor dem Durchbruch zur kommerziellen Nutzung.
- Genmanipulation ermöglicht erstmals die Veränderung von Lebewesen oder Stammzellen.
- Die hegemoniale, geopolitische Weltordnung wird neu geschrieben (Aufstieg der BRICS-Staaten, Bedeutungsverlust der alten Mächte).
- Die Menschheit wird zur interplanetaren Spezies und plant erste Siedlungen auf Mond und Mars.
- Gesellschaftliche Spannungen eskalieren immer häufiger zwischen alten und neuen Konfliktlinien.
Um Veränderungen besser einordnen und Strategien längerfristig planen zu können, greifen die bekannten Megatrends zu kurz. Gigatrends hingegen beziehen deutlich mehr Signale und Trends in ihre Beschreibung ein und stehen somit auf einem breiteren, wissenschaftlichen Fundament. Und bevor ich Sie zu lange auf die Folter spanne, möchte ich hier einen kurzen Überblick in die (noch unveröffentlichten) Gigatrends gewähren. Sie haben sich seit mehreren Jahrhunderten angebahnt und wirken auch noch weit in die Zukunft - und zwar global und in allen Bereichen der Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.
Gigatrend 1: Leviathanozän
Leviathanozän bezeichnet das Meta-Muster, welches zur Klimakrise geführt hat. Einige Hintergründe sind menschliche Eingriffe in die Ökosphäre sowie der verantwortungslose Umgang mit natürlichen Ressourcen, welcher maßgeblich von blinder Gier und einem Fehlverhältnis zu kapitalistischen Mechanismen herbeigeführt wurde. Die Geowissenschaften sprechen seit einigen Jahren vom Anthropozän, da sich die Folgen menschlichen Handelns längst in den Gesteinsschichten zeigen; andere schlagen bspw. den Begriff (engl.) "Chthulucene" vor. Mein Vorschlag geht weiter und verbindet die Elemente Erdzeitalter (-zän) mit dem Leviathan nach Thomas Hobbes Abhandlung über Politik und Macht (1651). Damit wird direkt begrifflich angedeutet, dass es sich um eine mehrere Jahrhunderte alte Entwicklung handelt.
Es ist schon faszinierend zu sehen, dass es gut 4,6 Milliarden Jahre gedauert hat, bis die Evolution des Planeten Erde eine mutmaßlich intelligente Spezies (homo sapiens) hervorbrachte - und der es innerhalb von knapp 300.000 Jahren schafft, seine eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Noch ist es nicht so weit, doch die Zeit wird knapp. Dieser Gigatrend beschreibt damit die wichtigsten Ursachen und Auswirkungen des Leviathanozän - und vermittelt auch ein Gefühl dafür, wie es weitergeht.
Gigatrend 2: Postkapitalismus
In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung ist inzwischen vielen klar geworden, dass das Wirtschaftssystem, das unsere Vorfahren durch die ersten Wellen der Industrialisierung getragen hat, einer Neuausrichtung bedarf. Die ursprüngliche "New Work"-Idee nach F. Bergmann, Konzepte der "Doughnut-Economy" oder Kreislaufwirtschaft behandeln bereits die Fragen, wie eine sozial inklusive und ökologisch verträgliche Wirtschaft funktionieren kann. Leider haben es diese Ideen sehr schwer, zur etablierten, tendenziell konservativen Entscheidungsriege vorzudringen. Agilität, Kollaboration und Exnovation bieten Lösungsansätze, wie sowohl Unternehmen als auch Volkswirtschaften die Transformation schaffen können; doch alles beginnt bei einem neuen Menschenbild, das wenig mit dem anachronistischen Humankapital- und Controlling-Ansatz zu tun hat. Oft wird der Begriff Postkapitalismus reflexartig mit einer Abneigung gegen Kommunismus quittiert, doch darum geht es hier nicht; eher um eine Integration unterschiedlicher Systeme. Welche Elemente kennzeichnen die Ökonomie der Zukunft?
Gigatrend 3: Große Beschleunigung
Wir sprechen von Digitalisierung, Konnektivität, Vernetzung und Internet - doch wenige erkennen das große Muster dahinter. Die Bevölkerungsentwicklung seit der Zeitenwende, Ausbreitung der Menschheit über dem Globus, Konfrontation mit unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und folglich "Innovation" bahnbrechender Entwicklungen haben sich schon früh angedeutet. Vielleicht ergeben sie auch erst in der Retrospektive eine logische Verknüpfung, doch genau darum geht es ja. Fragt sich: Wohin geht die Entwicklung? Bleibt die exponenzielle Kurve der technologischen Entwicklung erhalten? Wie verhält sich die technologische Geschwindigkeit im Verhältnis zur gesellschaftlichen und biologischen Komplexität?
Gigatrend 4: Vereinte Weltgemeinschaft
Kaum wurden die Menschen sesshaft und entwickelten komplexe Sprache (vor etwa 100.000 Jahren), begannen die Konflikte. Eine Prise Religion, dann der Maschendrahtzaun und schon hatten wir jahrzehntelange Kriege, Weltkriege, Kalte Kriege - Sie wissen schon. Wenn man die geopolitischen Konfliktlinien und -herde der letzten Jahre und sich andeutende Krisen analysiert, könnte man annehmen, dass es auch genauso weitergehen wird. Doch seit der Gründung der Vereinten Nationen, etwas später regionalen, transnationalen Verbünden wie der Europäischen Gemeinschaft, später Union, oder der Nato sollten größere Kriege der Vergangenheit angehören (was nicht immer gut funktioniert, wie wir aus den Kriegen im Irak, Afghanistan, der Krim, Bergkarabach, dem Nahost-Konflikt etc. wissen).
Doch seit Entwicklung von Atombomben stehen Mittel zur Verfügung, um in einer unkontrollierten Auseinandersetzung das Leben in weiten Teilen der Erde auszulöschen. Erzwungene Kooperation, wenn man so will. Fragt sich, wie es weitergeht, wenn die BRICS-Staaten, allen voran China und Indien, weiterhin ihr wirtschaftliches Wachstum aufrechterhalten können. Ein Ansatz zur friedlichen Integration und Inklusion findet sich in der uralten Idee der Tianxia. Im Gigatrend endet die Beschreibung der globalen Politik nicht heute, sondern einige Jahrzehnte oder Jahrhunderte in der Zukunft - wie kann es die Menschheit schaffen, sich nicht gegenseitig auszulöschen?
Gigatrend 5: Teilhabe
Der Zugang zu Nahrung, Sicherheit, Gesundheit, Einkommen, Bildung, Demokratie und anderen essenziellen Bestandteilen eines nach UN-Definition lebenswerten Lebens sowie gesetzlich verankerte Garantien für Minderheiten haben in den letzten 80 Jahren stetig zugenommen - wenn man von einigen Rückschlägen absieht. Immer mehr Staaten basieren auf rechtsstaatlichen Prinzipien, organisieren freie Wahlen für Parlamente oder Präsidentinnen, Minderheiten werden mindestens durch die Justiz geschützt. Auch die Gleichberechtigung von Frauen und nicht-binären Menschen (LGBTIQ*) hat sich drastisch verbessert. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns bis zur wahren Gleichberechtigung, doch wir sind bereits ein gutes Stück vorangekommen. Angefangen hat diese Entwicklung nicht etwa nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der Zeit der Aufklärung, sondern einige Jahrhunderte früher. Wohin führt uns der Weg der gleichberechtigten Teilhabe in Zukunft - dürfen dann auch Künstliche Intelligenzen an Wahlen teilnehmen?
Gigatrends: Kein Superlativ, sondern eine erweiterte Perspektive
An dieser Stelle endet meine kleine Einführung und, wenn Sie so wollen, die Vorschau auf mein Buch "Gigatrends". Es befindet sich noch in Entstehung, doch der Rahmen steht. Wenn Sie über die Veröffentlichung informiert werden wollen, tragen Sie sich am besten jetzt für meinen Newsletter ein; dieser erscheint maximal einmal im Monat, Sie brauchen also keine Angst vor einer E-Mail-Flut haben. Und wer weiß, vielleicht sehen Sie das Buch nächstes Jahr auch in Ihrem Buchladen - ich freue mich auf Ihr Feedback!
Wie wird Künstliche Intelligenz die Zukunft verändern?
Zu diesem Thema werde ich immer häufiger als Keynote Speaker angefragt. Das hat verschiedene Gründe – ich hoffe, dass mein Vorname* keiner davon ist. Es hat eher etwas damit zu tun, dass ich 1. Zukunftsforscher und 2. Hobby-IT-Nerd bin. 3. werden nur wenige technologische Entwicklungen unserer Zeit gleichzeitig derart über- und unterschätzt.
Eine derart globalgalaktische Fragestellung lässt sich in einem kurzen Blogbeitrag nur unbefriedigend beantworten. Aber ich möchte Ihnen gern ein Gefühl dafür geben und mir gleichzeitig Mühe, mich kurz zu fassen und trotzdem nicht zu viel auszuklammern.
Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?
Bevor wissenschaftlich geprägte Menschen sich einer Fragestellung nähern, klären wir immer erst die grundlegenden Definitionen. Bereits 1955 prägte der US-amerikanische Informatiker und Autor John McCarthy bei der „Dartmouth Conference“ den Begriff „Künstliche Intelligenz“. Theoretisch wurde natürlich bereits vorher über die potenziellen Denkfähigkeiten von Maschinen spekuliert, an der Stelle ist in erster Linie Alan Turing zu nennen. Dieser entwickelte auch den Turing-Test, welcher feststellen soll, ob eine Maschine in der Kommunikation noch von einem Menschen zu unterscheiden ist oder nicht. Der Turing-Award wiederum wird seit 1966 jährlich verliehen und ist so etwas wie der Nobelpreis für Informatiker:innen.
Künstliche Intelligenz ist dem Gehirn nachempfunden
Seit fast 70 Jahren steht nun also der Begriff Künstliche Intelligenz im Raum, doch praktisch hat die Entwicklung erst seit der Jahrtausendwende Fahrt aufgenommen. Das hat viel mit dem Geschwindigkeitsanstieg von Computerchips zu tun (s. Moore’sches Gesetz). Denn die Grundlage für KI ist natürlich genau das: sehr schnelle Rechenmaschinen, die in kurzer Zeit viele Daten verarbeiten können. Der Grundgedanke dahinter ist die Annahme, dass unser Gehirn letztlich auch nichts anderes tut als sehr viele Reize (= Daten), die permanent auf uns einprasseln, schnell zu verarbeiten. Wir nutzen dafür die Macht der Neuronen und Synapsen zwischen unseren Ohren; ein Computer nutzt dafür seinen Prozessor (CPU oder GPU) und die Festplatte (oder andere Speichereinheiten).
In unserem Hirn feuern die Synapsen in atemberaubender Geschwindigkeit, wenn bspw. ein optischer Reiz vom Auge ans Gehirn gesendet wird. Diverse Prozesse des Gehirns prüfen zunächst, ob der Reiz eine Bedrohung darstellt, ordnet den Reiz sodann in bekannte Muster ein und aktiviert die Datenverarbeitung – beispielsweise, um eine Handlung auszuführen oder erst einmal ausgiebig darüber nachzudenken. Jeder Mensch hat dafür seine eigenen Muster und Vorurteile, was auch einen Teil meines Slogans „Zukunft ist eine Frage der Perspektive“ begründet. Für die Thematik der Künstlichen Intelligenz ist für uns aber wichtiger, dass diese Datenverarbeitung unseres Gehirns schrittweise von der Informatik (und Kybernetik) imitiert wird, um automatisierte Denkmaschinen herzustellen. Manche sprechen bereits von Leben 3.0 (vor allem der MIT-Professor Max Tegmark), also einer synthetischen Form des Lebens, die sich ihrer selbst bewusst werden und nach eigener Agenda handeln könnte.
Definition Künstliche Intelligenz (EU)
Es ist nicht leicht, eine geeignete Definition Künstlicher Intelligenz zu finden. Ich habe mich für die Variante der High-Level Expert Group on Artificial Intelligence der Europäischen Kommission entschieden:
„Künstliche-Intelligenz-(KI)-Systeme sind vom Menschen entwickelte Software- (und möglicherweise auch Hardware-) Systeme, die in Bezug auf ein komplexes Ziel auf physischer oder digitaler Ebene agieren, indem sie ihre Umgebung durch Datenerfassung wahrnehmen, die gesammelten strukturierten oder unstrukturierten Daten interpretieren, Schlussfolgerungen daraus ziehen oder die aus diesen Daten abgeleiteten Informationen verarbeiten und über die geeignete(n) Maßnahme(n) zur Erreichung des vorgegebenen Ziels entscheiden. KI-Systeme können entweder symbolische Regeln verwenden oder ein numerisches Modell erlernen, und sind auch in der Lage, die Auswirkungen ihrer früheren Handlungen auf die Umgebung zu analysieren und ihr Verhalten entsprechend anzupassen.“
zitiert nach: Europäische Kommission (2020): Weißbuch: Zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, S. 19. Online: https://ec.europa.eu/info/publications/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust_en (Abruf am 20.01.2021)
Kurz: KI-Anwendungen sind technische Einrichtungen, die computergestützt Daten verarbeiten und autonom Entscheidungen treffen.
Kurz und laiengerecht: KI ist nicht, wenn eine Maschine etwas kann, was bisher nur Menschen konnten. KI ist, wenn eine Maschine etwas kann, aber niemand genau versteht, warum.
Was ist Künstliche Intelligenz nicht?
Intelligent.
Vieles im Feld der künstlichen Intelligenz wirkt geradezu magisch, wenn man die Grundlagen nicht durchdrungen hat. Das ist auch nicht schlimm, dafür haben Sie ja mich. Maschinen vollbringen zwar bereits Wunder, doch hat das wenig mit der „Intelligenz“ der Maschine zu tun.
Schwache Künstliche Intelligenz
Die wichtigsten Felder der Künstlichen Intelligenz tummeln sich unter dem Begriff des Maschinellen Lernens (inkl. Maschine Learning, Deep Learning, Artificial Neural Networks). Das Prinzip des Maschinellen Lernens (ML) orientiert sich zwar an Lernvorgängen biologischer Wesen, doch wird in der Regel sehr klar vorgegeben, was die Maschine erledigen und wie sie lernen soll (hier unterscheidet man noch das überwachte und unüberwachte Lernen). Dabei geht es bislang immer um sehr spezifische Problemstellungen, die von der Maschine gelöst werden sollen. Es ist also eine schwache Intelligenz (engl. narrow artificial intelligence).
Starke Künstliche Intelligenz
Das Ziel der Entwicklung, gewissermaßen der „heilige Gral“ der KI-Forschung, ist zwar die allgemeine KI (engl. artificial general intelligence). Doch davon sind wir noch viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte entfernt; manche nehmen sogar an, dass dieser Schritt unmöglich ist. Dazu müsste nämlich die Maschine ein Bewusstsein entwickeln – und wir müssten das auch erkennen. Der aktuelle Pfad zeigt in eine vollkommen andere Richtung: Menschen entwickeln begrenzt intelligente Maschinen, um die Probleme der Menschen und der Umwelt zu lösen. Ich habe weniger Angst vor einer bösartigen Künstlichen Intelligenz nach dem Terminator-Vorbild als vor einem irren Diktator, der perfekt trainierte Killermaschinen in den Krieg sendet. Daher befürworte ich auch ein Moratorium von KI-Systemen in bestimmten Bereichen, darunter auch Kriegsführung.
Schauen wir uns ein paar wichtige Meilensteine der Künstlichen Intelligenz an, um zu verstehen, wo wir stehen.
Status Quo (ausgewählte Use Cases)
Seit gut zehn Jahren überschlagen sich die Meldungen über Durchbrüche in der KI-Entwicklung. Ich habe ein paar Schlaglichter für Sie ausgewählt, mit denen Sie mindestens im Freundeskreis, vielleicht sogar in der Geschäftsführung punkten können:
2011: IBM Watson gewinnt bei Jeopardy
Der von IBM entwickelte Supercomputer Watson wurde 2011 auf die zwei besten menschlichen Kandidaten in der Quizshow Jeopardy losgelassen. Die Show funktioniert so, dass die Moderation eine Antwort nennt und die Kandidat:innen die gesuchte Frage finden müssen. Watson wurde darauf trainiert, alle vorigen Sendungen mit einer Lexikon-Datenbank zu verknüpfen sowie natürliche Sprache zu verstehen. Darüber hinaus wurde er mit einer begrenzten Risikobereitschaft ausgestattet, denn bei derart offenen Fragestellungen kann man nicht immer auf die hundertprozentige Gewissheit warten, bis man den Buzzer drückt. Sie ahnen bereits, wer als Sieger aus dem Spiel ging: Watson. Schauen Sie selbst:
Das ist nett, doch für die echte Welt noch wenig hilfreich. Das hat sich schon bald geändert, als Watson bereits 2013 für den Einsatz in der Onkologie weiterentwickelt wurde. Seither gilt Watson als bester Krebsdiagnostiker der Welt dank seiner übermenschlichen Fähigkeit, beliebig viele Daten zu kombinieren und bspw. MRT-Bilder von Patienten mit der Datenbank bekannter Krebsarten zu korrelieren. Das Ergebnis seiner Berechnung erscheint nach wenigen Sekunden auf dem Tablet des behandelnden Arztes, der sehr viel schneller und effizienter eine Aussage treffen und ggf. eine Therapie wählen kann:
2011: Sprachassistenten auf dem Vormarsch
Sprechen Sie gelegentlich mit Siri, Alexa, Hey Google, Cortana oder Bixby? Das sind die beliebtesten Sprachassistenten, die inzwischen von ungefähr drei Vierteln der in Deutschland lebenden Menschen genutzt werden – sogar beim Banking. Die Grundlage ist das sogenannte Natural Language Processing (NLP), also die Verarbeitung natürlicher Sprache. Da wenige Menschen eine komplett korrekte Aussprache haben, mussten die Assistenten lernen, Dialekte zu erkennen, Betonungen zu gewichten und all das, was unser Ohr und Gehirn sonst für uns übernimmt zu lernen. 2011 kam Siri auf den Markt und war noch vergleichsweise dumm, konnte nur eine kleine Bandbreite vorgefertigter Sprachbefehle verarbeiten – und das nur dann, wenn der Mensch sehr deutlich gesprochen hat. Das hat sich seither geändert, weil inzwischen Milliarden bis Billionen Aufnahmen verarbeitet und analysiert wurden, um daraus neue Muster zu erkennen. Daraus entsteht für die Nutzer:innen ein klarer Vorteil, nicht zuletzt für wenig technikaffine Menschen sind Sprachassistenten ein einfacher Zugang zu Technologie, bspw. um im Smart Home Licht, Musik oder Temperatur sowie im modernen Fahrzeug das Navigationssystem freihändig zu steuern.
Andere Anwendungen kombinieren die Sprach- mit der Stimmanalyse, um Marker in der Stimme zu analysieren und wahlweise den emotionalen Zustand (engl. affective AI), psychologische Grundbedingungen oder schwere Erkrankungen darin zu erkennen.
2016: AlphaGo bezwingt den besten Go-Spieler
Als ein Schachcomputer 1997 gegen den damaligen Weltmeister Garry Kasparov gewann, staunte die Welt. Das hatte nur bedingt etwas mit KI zu tun, weil Schach zwar einerseits als Spiel der Könige ein gewisses Strategieverständnis voraussetzt, letztlich aber vor allem Erfahrung und Vorausdenken kommender Kombinationen und Zwänge des Gegners erfordert. Das war relativ leicht programmiert. Anders sieht es beim chinesischen Brettspiel Go aus, in dem es ungleich mehr Kombinationen gibt (mehr als Atome im Universum). Man kann einer Maschine nach heutigem Stand nicht alle möglichen Kombinationen beibringen, weil das Brett größer und die Funktionen der Figuren weniger determiniert sind. Deshalb dachten selbst führende KI-Expert:innen bis 2016 auch, dass es noch mehrere Jahre oder Jahrzehnte dauern würde, bis ein Computer gegen einen menschlichen Go-Spieler gewinnen könnte. Sie lagen falsch.
In einem atemberaubenden Duell trat der damals beste Spieler Lee Sedol gegen AlphaGo an, welches von Alphabet (Googles Mutterkonzern) entwickelt wurde. Der Computer gewann deutlich mit 4:1 und verblüffte vor allem durch seine Kreativität; einige Spielzüge konnte die Fachwelt und die Kommentatoren einfach nicht einordnen. Sie erschienen zunächst irrational, haben sich aber viele Runden später als raffinierte taktische Manöver entpuppt. Inzwischen gibt’s sogar eine Dokumentation zu AlphaGo:
Auch hier stellt sich wieder die Frage, wo der Sinn in einer Maschine liegt, die Menschen in ihren eigenen Spielen schlagen. Ganz einfach; AlphaGo wurde bald zu AlphaFold und begann, die grundlegenden Muster der Biologie zu erforschen. Die KI bzw. das maschinelle Lernen von AlphaFold erreichte Ende 2020 den Durchbruch und sagte die Proteinstruktur basierend auf der Aminosäuresequenz des Proteins voraus; eine 50-Jahre alte Herausforderung der Biologie. Wozu nützt das? Viele Krankheiten sind direkt mit Proteinfunktionen verknüpft, darunter Krebs und Demenz. Das bedeutet, nun können Forscher:innen besser Krankheiten verstehen und hoffentlich bald wirksame, potenziell auch individualisierte Gegenmittel dazu entwickeln:
Ein ähnliches Verfahren wurde übrigens von Pharmazieunternehmen angewandt, um Gegenmittel für Covid-19 zu entwickeln. Bedeutet in kurz: Künstliche Intelligenz beschleunigt die Forschung und Entwicklung in der Medizin und Pharmakologie enorm.
2019: Bildmanipulation in (bald) Echtzeit mit StarGAN v2
In Zeiten von Fehlinformationskampagnen und Fake News fehlte gerade noch eine Software, die beliebige Bilder manipulieren kann. Donald Trump zeigt den Hitlergruß? Kein Problem, StarGAN kann das. Hitler umarmt Barack Obama? Auch das dürfte kein Problem sein, doch spätestens hier würden historisch Gebildete den Fehler bemerken. Das ist leider nicht immer so, da die Fälschungen immer besser werden. Mitschuld daran trägt die Technologie „StarGAN“ (das GAN steht für „Generative Adversarial Networks“). 2019 haben Forscher:innen das erste Mal diese Netzwerke antrainiert und vorgeführt, die Weiterentwicklung wurde bereits wenige Monate später unter Open Access veröffentlicht. Sehen Sie hier, was die KI kann:
In wenigen Jahren erwarte ich daher Film- und Serienproduktionen, die komplett ohne Set und Schauspieler:innen produziert wurden – und dennoch mit realistischen Figuren bestückt sind. Und wer weiß, vielleicht werde ich auch meine Vorträge mit StarGAN automatisieren?!
2020: Textautomatisierung mit GPT3
Schließlich ein wichtiger Durchbruch auf dem Gebiet der automatisierten Texterstellung. Das Kürzel GPT3 steht für „Generative Pre-trained Transformer 3“ und ist die Weiterentwicklung eines von OpenAI initiierten Projekts, um Texte von KIs schreiben zu lassen. Die beiden Vorläufer waren schon erstaunlich, doch GPT3 toppt alles vorher Dagewesene. Die britische Tageszeitung „The Guardian“ hat einen kompletten Artikel aus der „Feder“ von GPT3 veröffentlicht:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3
Kurz darauf traten Studierende gegen GPT3 in einen Wettbewerb um das bessere Essay – raten Sie, wer gewann: https://mixed.de/openai-gpt-3-vs-studis-wer-kriegt-die-besseren-noten/
… genau, die KI. Professor:innen haben den Unterschied nach kleineren Anpassungen nicht festgestellt:
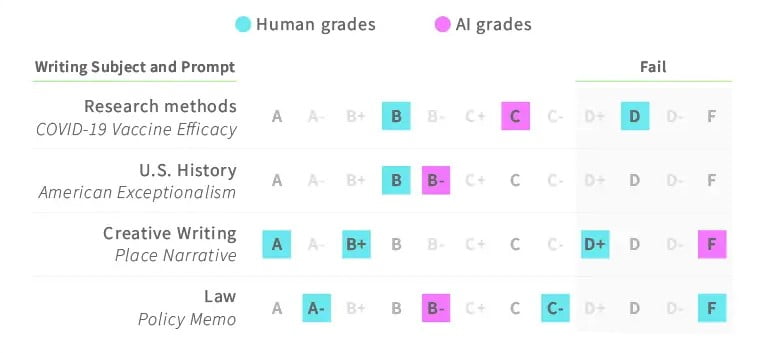
Lustige Anwendungen
KI-Anwendungen werden auch oft noch eher experimentell und vor allem von einer großen Community von IT-Geeks entwickelt. Diese Seite listet kostenlose, meist unterhaltsame Anwendungen auf – darunter ein Kunstsimulator, eine Songtexte-KI oder KI-colorierte Filmklassiker: https://boredhumans.com/
Business-Anwendungen
In meinen Vorträgen zeige ich auch je nach Kontext aktuelle Anwendungen aus den Bereichen Justiz, Personalwesen, Mobilität (v.a. autonomes Fahren), Bildung, Handwerk, Medizin, Maschinenbau (und viele mehr) und was eben gerade passt. Das würde hier aber den Rahmen sprengen. Ich würde behaupten, dass es keine größere Branche gibt, in der es nicht bereits Anwendungen gibt, die Prozesse mithilfe von KI automatisieren oder autonomisieren. Gleichzeitig arbeiten KI-Forscher:innen weltweit daran, KI-Anwendungen erklärbar zu machen – subsumiert unter dem Stichwort explainable / intelligible AI (erklärbare oder sich selbst erklärende KI).
Nehmen Sie gern Kontakt auf, wenn Sie eine individualisierte Zusammenstellung in Keynote-Form interessiert.
Ausblick 2050: Transmodern Liberty
Was kommt danach?
Klassischerweise schauen Zukunftsforscher:innen eher 5-10 Jahre in die Zukunft. Aber dazu erscheint dieses Jahr noch ein Buch, dessen Mitherausgeber ich bin („Arbeitswelt und Künstliche Intelligenz 2030“). Daher möchte ich hier den Blickwinkel auf die fernere Zukunft richten: 2050.
Die Schnittstelle von KI-Anwendungen ist: Bei dieser Welle der Industrialisierung geht es nicht (nur) darum, physische Körperkraft auf Maschinen zu übertragen, sondern auch kognitive Fähigkeiten. Daher sind auch hochqualifizierte Akademiker:innen nicht sicher vor Automatisierungstendenzen. Die Auswirkungen davon können sehr vielseitig sein und werden je nach Wirtschafts- und Gesellschaftskontext in den nächsten Jahrzehnten sehr unterschiedlich bewertet werden. In den meisten industrialisierten Volkswirtschaften ist ein (bedingungsloses) Grundeinkommen sehr wahrscheinlich – nicht zuletzt, da es von der aktuellen Wirtschaftselite sogar vorangetrieben wird. Wer zahlt die Steuern? Na, die Roboter und Algorithmen!
Mein Zukunftsbild im technologischen Bereich nennt sich „Transmodern Liberty“. Der Begriff setzt sich aus den Elementen einer Transmodernen Gesellschaft sowie einer neuen Qualität des Freiheitsbegriffs zusammen und ist eine optimistische Variante der Zukunft. Mein Szenario beinhaltet unter anderem folgende Aspekte:
Technologie macht Menschen menschlich
Was widersprüchlich klingt, ist mein voller Ernst. Der richtige Einsatz der Technologie, allen voran Künstliche Intelligenz, könnte im besten Fall dazu führen, dass erstmals in der Geschichte der Menschheit alle Menschen menschlich sein dürfen. Was heißt menschlich? Für mich heißt das, sich nicht tagtäglich um die Versorgung existenzieller Bedürfnisse kümmern zu müssen. Dieses Privileg war seit Beginn der Menschheit (wenn überhaupt) einer kleinen Elite vorbehalten. Doch wenn die Grundbedürfnisse durch automatisierte Prozesse gedeckt werden können, entsteht zumindest die Möglichkeit, dass Erwerbsarbeit obsolet wird – stattdessen gehen Menschen „arbeiten“, weil es ihren individuellen Stärken und Interessen entspricht und sie dadurch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten.
Sapiens 2.0 wird geboren
Oft spreche ich in meinen Vorträgen über den Homo Prospectus als zukunftsdenkenden Menschen. Das ist ein Bestandteil einer neuen Form der Menschlichkeit; damit sind nicht genetisch optimierte Menschen gemeint, sondern diejenigen mit einem kosmopolitischen Mindset und dem Verständnis der Transmodern Liberty. Sie basieren auf einer aktualisierten Fassung der Aufklärung und des Humanismus, erkennen jegliches Leben als gleichwertig an und sind ohne äußere Zwänge frei in der Entfaltung der eigenen Biographien.
Automatisierung der Diplomatie und Global Governance
Neben der Produktion alltäglicher Güter und der Infrastruktur muss natürlich auch die Staatsführung automatisiert werden. Wem nützt es, wenn innerhalb einiger geschlossener Nationalstaaten die Wirtschaft automatisiert wird, der Nachbarstaat aber regelmäßig diplomatische Krisen verursacht oder Spitzenbeamten und -politiker:innen korrupt sind? Eben. Hier erkennen wir zunehmend den Trend zu einer echten Tianxia, also einem global inklusiven Politiksystem: Es erkennt einerseits die kulturellen und historischen Verschiedenheiten der Menschen und Territorien an, nivelliert andererseits aber menschliche Abgründe wie Gier, Hass oder Rache durch kluge Diplomatie. Wenn ein Computer im Go gegen einen Menschen gewinnt, wird er jawohl auch bald eine diplomatische Krise moderieren können. Fragen Sie mal die Menschen in Krisen- und Kriegsgebieten, die haben schon heute keine Lust auf Terror.
Zurück in die Gegenwart
Künstliche Intelligenz wird die Welt mindestens genauso stark verändern wie Strom oder die Bändigung des Feuers. Das sage nicht ich, sondern Google CEO Sundar Pichai 2018, doch ich stimme ihm zu. Gleichzeitig setze ich mich dafür ein, mehr Aufklärung zu schaffen und das Thema zu entmystifizieren. Die Erwartungen für das laufende Jahrzehnt reichen von der Angst vor einem Terminator-Szenario oder Komplettautomatisierung bis zu Unverständnis für „dieses lästige Informatik-Gequatsche“ und dem verheerenden Digitalisierungsnotstand in Deutschland. Damit muss endlich Schluss sein.
Wir brauchen mehr Aufklärung, bessere Bildung, mehr Information aber auch beherzte Diskussionen zur Primetime. Ich bin für viele Initiativen offen, daher: sprechen Sie mich an, wenn Sie das auch so oder so ähnlich sehen. Oder laden Sie mich als Redner ein, der Ihnen und Ihrem Publikum genug Gedankenfutter für die kommenden Jahre auf den Weg gibt.
* auf Deutsch und Englisch steckt ja das Kürzel für Künstliche Intelligenz in meinem Vornamen. Vielleicht ist es aber auch kein Zufall!?
** Der Vollständigkeit halber für meinen Sprachfimmel: Künstliche Intelligenz wird die Zukunft genauso wenig verändern wie alles andere. Sie wird sie aber prägen.
Photo by Morning Brew on Unsplash
Bill Gates: Wie wir die Klimakatastrophe verhindern (Rezension)
Bill Gates ist ein polarisierender Mensch. Er ist ...
- einer der Gründer von Microsoft, einem der nach wie vor erfolgreichsten und wertvollsten Technologieunternehmen der Geschichte.
- der Erfinder von Windows, einem der Gründe, dass fast jeder Mensch Zugang zu einem Personal Computer und dem Internet hat.
- einer der reichsten Menschen aller Zeiten - als Folge der ersten zwei Punkte.
- Philanthrop und als Mitgründer der Melinda und Bill Gates Foundation einer der größten Geldgeber für karitative Projekte, die zum Aussterben einiger schlimmer Krankheiten besonders in Schwellen- und Entwicklungsländern beigetagen haben.
- Technologie-Junkie, der für jedes Problem der Menschheit mindestens eine technologiebasierte Lösung kennt.
- einer der wenigen Businessmenschen, die keinen Hehl daraus machen, sich in die Politik einzumischen; seit vielen Jahren gehört er zum Inventar globaler Veranstaltungen - bei der Münchener Sicherheitskonferenz am 19. Februar 2021 war er der einzige Nichtpolitiker auf der Agenda.
- Ziel diverser Verschwörungstheorien, die sich in ihrer Absurdität gegenseitig übertrumpfen, wohl als Folge aller obigen Punkte.
All das weiß Bill. Nun hat er mit "Wie wir die Klimakatastrophe verhindern" (original: "How To Avoid a Climate Disaster") einen Ratgeber vorgelegt, der wohl die Bestsellerlisten stürmen wird. Veröffentlicht am 16. Februar reicht ein Blick in die Bewertungen auf beliebigen Portalen, um ein Gefühl für die Polarisierung dieser Person und natürlich auch des Buchs selbst zu bekommen. Deshalb habe ich mir das Buch sofort bei Veröffentlichung bestellt, gelesen und diese Rezension verfasst. Wer das Buch selbst noch lesen möchte, sollte die Inhaltsübersicht überspringen.
Update: Dank mehrfacher Rückfrage habe ich auch eine Podcast-Episode mit ausführlicherer Kritik und persönlicher Note dazu aufgenommen.
Tenor: Die Welt geht unter, aber ...
Bill Gates ist bekannt als sympathischer, superreicher Nerd, der sich sowohl verständnisvoll und geduldig als auch wahnsinnig klug inszeniert. Es wundert daher nicht, dass auch sein neuestes Buch rhetorisch brilliant formuliert und komponiert ist. Der Aufhänger dafür ist schnell umrissen:
- Die Welt geht unter: Das 1,5-Grad-Ziel aus dem Pariser Klimaabkommen ist so gut wie verloren. Wenn wir nichts tun, werden die Folgen für alle Menschen auf der Welt verheerend sein - für die Ärmsten der Armen natürlich zuerst.
- Das Ziel ist zwar einigermaßen klar, aber die Pläne zur Erreichung nicht. Und es gibt (oft nachvollziehbare) nationale oder regionale Interessen, die eine schnelle Umkehr zu einer "grünen" Strategie verhindern. Die Anreizsysteme müssen global angepasst werden.
- Viele Zusammenhänge des Klimawandels sind wissenschaftlich gut erforscht und doch noch nicht in letzter Konsequenz bei allen angekommen. Mit diesem Ratgeber möchte Bill Gates dieses Vakuum nutzen.
Die Hoffnung aus der Einleitung ist also im Wesentlichen: die Welt geht unter, aber wenn wir jetzt - und in den nächsten 30 Jahren - alles richtig machen, haben wir gute Chancen auf ein Leben in Wohlstand, Reichtum und endlos verfügbarer, sauberer Energie.
Inhaltsübersicht: Onkel Bill erklärt die Welt
Bill Gates hört man gern beim Reden zu, denn er erklärt die Welt immer so, als wäre eigentlich alles ganz einfach. Dabei nutzt er sehr einfache Sprache, erklärt Fachbegriffe unaufdringlich, sodass sich weder der Leser beschränkt vorkommt, der den Begriff vorher nicht kannte, noch diejenige genervt fühlt, die täglich damit operiert. Diese sprachliche Komponente darf man nicht unterschätzen; sie ist einer der Gründe, warum ich wie gesagt davon ausgehe, dass die Bestseller-Position schon gesichert ist.
Und es gibt ein weiteres "trotz": Gates stellt zwar viele Themen immer wieder in den globalen Kontext, nennt vereinzelt Beispiele aus Europa, Asien, Afrika, Lateinamerika und Ozeanien; im Wesentlichen geht es aber um die USA. Und die scheinen auch der Adressat des Sachbuchs zu sein, also die Landbevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika. Die, die den Klimawandel immer noch nicht ernst genug nehmen, immer noch mehr übertrieben schwere Fahrzeuge kaufen und billig betanken, mehr Fleisch konsumieren als der Rest der Welt zusammen und mit kruden Methoden billiges Erdöl und -gas verbrennen, als wäre das folgenlos für den Planeten.
In zwölf Kapiteln nimmt Onkel Bill die Leser:in also an die Hand und erzählt eine in sich sehr konsistente Geschichte davon, wie die Klimakrise verhindert werden kann, warum das überhaupt wichtig ist und welche Gesellschaftsbereiche zu welchem Grad zum Klimawandel beitragen - und welche Lösungen wir benötigen, um das zu stoppen. Hier die wichtigsten Aussagen aus den zwölf Kapiteln, im Anschluss die Bewertung:
- Wir müssen es bis 2050 schaffen, keine weiteren Treibhausgase zu emittieren bzw. mehr Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entfernen, als wir hineinblasen.
- Das ist allein deshalb eine Mammut-Aufgabe, da der jährliche Energiebedarf bis dahin um mindestens 50% ansteigen wird und gleichzeitig die Nutzwerte erneuerbarer Energien leider - anders als bei Moore's Law - nicht exponenziell wachsen, und weil die Politik zu kurzfristig denkt.
- Für alle klimawandelintensiven Produkte und Prozesse gibt es mehr oder wenig gut zugängliche "Green Premiums", die oft so teuer oder unattraktiv sind, dass sie zu lange brauchen, um sich durchzusetzen (Beispiel Elektroautos oder Recycling-Baustoffe).
- Der Strombedarf allein wird sich bis 2050 verzwei- bis verdreifachen, insbesondere Schwellen- und Entwicklungsländer müssen dazu auf fossile Energieerzeugung zurückgreifen, da sie schlicht günstiger und effizienter sind; die einzige Option ist es daher, Kernkraft aus der Schmuddelecke zu holen und dezentrale, kleine, dafür aber moderne Kernkraftwerke zu bauen (die emittieren kaum CO2).
- Fast ein Drittel der Treibhausemissionen stammt aus der Produktion moderner "Dinge" wie Zement, Beton, Plastik, Glas, Aluminium oder Dünger; da durch die erwartete Wohlstandsentwicklung im Globalen Süden in den nächsten Jahrzehnten ein dauerhafter Bau-Boom erwartet wird, werden auch diese Bereiche stark wachsen und müssen a) mit "nachhaltigen" Energien versorgt werden und b) wiederverwertete oder aufgewertete Baustoffe mit einbeziehen.
- Rinder sind einer der größten Treiber des Klimawandels und stoßen allein gut 4% der globalen Treibhausgasemissionen aus (!), industrielle Tierhaltung ist aus diversen Gründen ökologischer und sozialer Irrsinn, weshalb alternative Lebensmittel und Landwirtschaftsformen gefördert werden müssen.
- Transport und Mobilität machen insgesamt nur 16% der globalen Treibhausgasemissionen aus, aber immerhin - alternative Kraftstoffe müssen so schnell wie möglich Benzin und Diesel ersetzen, aber besonders die großen Fahr-, Flug- und Schwimmzeuge könnte man auch mit kleinen Atom-Reaktoren bewegen.
- Wohnräume zu kühlen oder zu erwärmen wird angesichts des Klimawandels und der Wohlstandssteigerung des Globalen Südens immer mehr Emissionen produzieren, weshalb Klimaanlagen und Heizungen sehr schnell grüner werden müssen.
- Der Klimawandel trifft die Ärmsten am härtesten, nicht zuletzt weil diese oft in Regionen leben, in denen die Auswirkungen extremer Wetterereignisse sich am heftigsten zeigen; Trinkwasseraufbereitung und Küstenschutz sollten schnell mehr Menschen zugänglich gemacht werden, was wiederum auf lange Sicht sehr viel Geld spart.
- Politik und staatliche Anreize für Forschung und Entwicklung spielen eine zentrale Rolle auf dem Weg, damit der Markt in die richtige Richtung gelenkt wird.
- Bis 2030 werden wir die Emissionen nicht auf "null netto" bringen, nicht zuletzt wegen der Covid-19-Pandemie, die vieles ins Wanken gebracht und Prioritäten verschoben hat; staatliche Förderung in F&E muss verfünffacht werden, die Preise für CO2 müssen wirksam erhöht werden und Welthandel muss an Klimaeinhaltung gebunden sein.
- Jede:r von uns ist Konsument, politisches Individuum, Mitarbeiter und/oder Arbeitgeber; es gibt nicht die eine Antwort, aber wir können alle einen Beitrag leisten.
Klimawandel ist die Wurzel, aber...
... alles, was wir in der "modernen Zivilisation" machen, zahlt darauf ein. Nahezu alles um uns herum produziert nach heutigem Stand von der Produktion bis zur Entsorgung Emissionen und die Errungenschaften der letzten 200 Jahre basieren auf billiger, aber schmutziger Energie.
Ich hatte schon vor der Lektüre damit gerechnet, dass das Thema Kernenergie bzw. Atomkraft eine wesentliche Rolle in dem Buch spielen wird, um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: die Treibhausgasemissionen zu senken, während der Energiebedarf der wachsenden Weltbevölkerung weiterhin steigt. Gates macht seine eigene Position sehr transparent, nicht zuletzt da man weiß, dass er die Forschung des Unternehmens TerraPower maßgeblich vorantreibt und finanziert. Ziel des Unternehmens ist es, kleinere Kernkraftwerke zu etablieren, die weniger Abfall erzeugen als herkömmliche Reaktoren und somit eine Zwischenlösung für die Übergangszeit in der Dekarbonisierung sein können. Dass das Thema insbesondere seit dem Reaktorunglück von Fukushima und anderen stark polarisiert, ist offensichtlich. Die Debatte ist emotional und trägt zumindest offiziellen Statistiken nur wenig Rechnung - so bleibt es je nach Betrachtung alternativlos, den Energiehunger der Menschheit zu sättigen. Wie mit dem radioaktiven Müll umgegangen werden soll, der zwar weniger als bei herkömmlichen Kraftwerken ausfällt, aber immer noch ein Problem darstellt, diskutiert der Autor leider nicht.
Fazit: Lesen!
In der Essenz liest sich Bill Gates' Buch einfach weg und wer sich schon einmal mit Klimawandel beschäftigt hat, wird viele bekannte Fakten wiederfinden. Den Vorwurf einiger Kritiken, Bill Gates würde in diesem Buch lediglich auf eine technologische Lösung der Klimakrise pochen, teile ich nicht: Alle Kapitel zeigen die Verstrickung technologischer Lösungen mit gesellschaftlichen Dynamiken und politischen Ansätzen. Das Buch zeigt meiner Meinung nach, dass wir eigentlich schon alles wissen und nur noch die Bereitschaft fehlt, auf globaler Ebene wirklich wirksame und verpflichtende Schritte zu verabschieden. Diese dürfen jedoch nicht bloß in Legislaturen gedacht werden, sondern müssen den Horizont deutlich erweitern; und da wird es knifflig. Insofern scheint der Subtext des Buchs auch zu schreien: Liebe FridaysForFuture, bleibt laut und unbequem, bis wirklich verbindlich gehandelt wird.
Kurz: Eine lesenswerte Lektüre.
Rezensierte Ausgabe: Bill Gates (2021): How to avoid a climate disaster, Penguin Random House, UK. 1. Auflage, ISBN: 978-0-24144830-4.
Auf deutsch bei Buch7 bestellen.
Wie wird der Corona-Sommer 2021?
Ausnahmezustand seit einem Jahr. Alle Welt hofft auf Lockerungen, Aufatmen, Impfungen, zurück zu Normal. Das System steht auf dem Prüfstand - wie geht es weiter?
Nach dem Corona-Winter ist vor dem Corona-Winter
Während ich diese Zeilen schreibe, ist noch Winter - Ende Februar 2021. Falls Sie das hier deutlich später lesen, zur Erinnerung: Klimawandel sei Dank hatten wir im Februar europaweit eine heftige Kältewelle, ausgelöst durch verirrte Polarwirbel - gefolgt von den wärmsten Februartagen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen (dazu habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen).
Nun, da der Frühling den Fuß in der Tür hat, hoffen viele auf Lockerungen der Pandemieauflagen. Doch sie werden leider weitere Enttäuschungen hinnehmen müssen; Virologen sind sich einig, dass insbesondere die neuen, mutierten Varianten des Sars-Cov-2-Virus (vor allem B.1.1.7 und B.1.351) noch ansteckender sind als die ursprüngliche Virusform. Da wir alle im letzten Jahr viel über exponentielle Entwicklungen gelernt haben, können wir uns mit einfachen Mitteln selbst ausrechnen, was das für die Verbreitung und Ansteckungsgefahr bedeutet: Die Infektionszahlen (und damit auch die Inzidenzwerte, also Infektionen pro 100.000 Einwohner:innen) steigen noch schneller, wodurch kritische Werte überschritten werden und Einschränkungen des öffentlichen Lebens bestehen bleiben oder sogar verschärft werden. Ob dadurch auch die Sterberate steigt oder sich das Virus abschwächt, wird derzeit diskutiert. Dennoch: wir müssen aktuell davon ausgehen, dass Corona uns noch eine Weile begleiten wird.
Nun stehen wir wieder mitten in der Zwickmühle. Außer Stillstand scheint es keine Option zu geben - und das ist auch der Punkt, an dem staatliche Maßnahmen zu Recht kritisiert werden. Inzwischen liegen jedoch auch ausreichend Erkenntnisse über verschiedene nationale Strategien vor; der "schwedische Weg" ist gescheitert, komplette Verleugnung (der weißrussische oder tansanische Weg) ebenso. Dann wäre da noch die Wahlkampfvariante aus den USA, wo bislang am meisten Menschen an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben sind - ein tragisches Armutszeugnis für die mächtigste Nation der Welt. Dann wäre schließlich ein letzter Hardliner-Weg zu erwähnen, dem viele nicht so Recht trauen: China hat mit der bekannten diktatorischen Härte und harten Quarantäne-Auflagen für sämtliche Einreisende angeblich das Virus ausgerottet. Aus irgendwelchen Gründen glauben wir diesen Meldungen weniger als denen aus Ozeanien, denn auch in Neuseeland und Australien (zusammen ca. 12 Millionen Einwohner) gibt es nahezu keine Fälle mehr.
Deutschland hat sich für eine der sozialsten und gleichzeitig teuersten Varianten entschieden. Und warum? Weil wir können. Und weil die Bundestagswahlen in diesem Jahr anstehen.
Corona und Bundestagswahlen
Was haben nun die Wahlen mit der deutschen Corona-Strategie zu tun? Das ist eigentlich ganz einfach.
Welche Menschen sind durch Corona am stärksten gefährdet? Faustregel: Je älter, desto schlimmer. Genauer gibt es einen signifikanten Anstieg der schweren Krankheitsverläufe ab einem Alter von 50 Jahren. Ein Blick auf die Bevölkerungspyramide verrät, warum diese Menschen nun besonders geschützt werden: Weil sie in der Überzahl sind. 45% der Bevölkerung in Deutschland sind 50+ Jahre alt, 16% unter 18 Jahren, bleiben noch 39% für die 18- bis 49-Jährigen. Und wer wählt wie? Laut Bundeswahlleiter bewahrheitet sich auch hier eine einfache Faustregel: Je älter, desto konservativer.* So ist es die offensichtlich alternativlose Option, insbesondere die ältere Bevölkerung zu schützen.
Verstehen Sie mich nicht falsch, aus (neo-)humanistischer Perspektive finde ich es richtig, Menschenleben zu schützen - unabhängig vom Alter, Herkunft, sexueller oder kultureller Identität etc. Die Wahl der Corona-Strategie in Deutschland folgt aber leider nur bedingt humanistischen Idealen, sondern einem klaren machtpolitischen Kalkül. Politikberatungen werden im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl im September sehr genau darauf geachtet haben, welche soziodemografischen Schnitte sich mit und ohne Corona ergeben. Das Alter (und damit das statistische Risiko einer schweren Erkrankung) ist nach wie vor eine sehr einfache Linie für den Wahlkampf.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir letzten Frühling einen harten Lockdown für vier Wochen durchgeführt. Doch das war natürlich nicht vermittelbar, da die Menschen mehr Angst vor einer Diktatur haben als dem Virus. Und damit sind wir beim nächsten Abschnitt.
Querdenker töten
Das Wortspiel habe ich von Die PARTEI kopiert. Natürlich soll die Überschrift keine Handlungsempfehlung sein, ich hoffe, Sie ergänzen sie im Kopf mit dem Akkusativobjekt: "Menschen". Warum, löse ich im letzten Absatz dieses Abschnitts auf.
Verschwörungsmythen gehören zu den Menschen wie die Gute-Nacht-Geschichte. Letztere hat einen pädagogischen Zweck und wird in fast allen Kulturen praktiziert. Erstere kann unterhaltsam sein, solange sie klar als Fiktion gilt oder tatsächliche Zusammenhänge aufdeckt - wenn nicht, ist sie mitunter gefährlich. Offensichtlich hat eine ganze Generation zu viel Akte X geschaut, während sie den Geschichtsunterricht geschwänzt hat. Über Jana aus Kassel wurde schon viel gesagt und geschrieben. Kurz: Sie ist als denkwürdiges Beispiel in die Mediengeschichte eingegangen, was alles falsch laufen kann und warum wir immer noch nicht genug für die Aufarbeitung unserer Geschichte tun (falls Sie das verpasst haben).
Ich habe mir viel Mühe gegeben, die "Querdenken-Bewegung" zu verstehen, deren Ängste und persönlichen Motive. Ich habe mich in Social Media auf lange Diskussionen eingelassen, viel Zeit und noch mehr Nerven investiert. Dabei habe ich immer wieder gefragt, woher die Rage kommt und vor allem, welche Quellen zu den teilweise haarsträubenden Behauptungen herangezogen wurden. Letztlich bin ich zu einer sehr einfachen und gleichsam traurigen Erkenntnis gelangt: Die gemeinsame Schnittmenge der Querdenker ist eine bedingungslose Ablehnung wissenschaftlicher Methode oder Rationalität. Die einzigen Argumente, die ich den Diskussionen und Aufnahmen von Demonstrationen entnehmen konnte, sind individueller und emotionaler Natur. Das macht sie nicht verboten, aber man muss sie als solche kennzeichnen.

Und damit wären wir wieder beim Thema Schwarmdummheit (auch dazu gibt's eine Podcast-Episode). Wenn Menschen sich gehört fühlen, folgen sie oft blind dem Anführer - so wie A. Hildmann oder A. Hitler (wobei der Vergleich zum Glück gewaltig hinkt). "I want to believe", so das Motto aus der Serie Akte X. Und tatsächlich sind wir so gut darin, dass der Glaube wirklich manchmal Berge versetzt - wenn wir nur konsequent genug an etwas glauben, finden wir plötzlich überall Belege dafür. Querdenker finden vielfach Belege für die wirren Behauptungen - in Blogs, auf einigen Youtube- oder Tiktok-Kanälen, von Nachbar Schneider. Das individuelle Weltbild wird damit verdichtet und alles ergibt einen gruseligen Sinn. Leider sind sie dann oft resistent gegen eine kritische Infragestellung ihrer Annahmen; also wirklich wissenschaftliches Vorgehen. Es ist nicht immer gut, der Masse zu glauben, aber wie wahrscheinlich ist es, dass >90% der unabhängigen Forschungsinstitute der Welt und daran angegliedert Millionen erfahrener Wissenschaftler:innen sich irren und eine globale Verschwörung der Superreichen unterstützen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass Nachbar Schneider einfach nur seiner allgemeinen Unzufriedenheit Ausdruck verleihen will, in Wirklichkeit aber keine Ahnung von Viren und Politik hat?
Die pandemischen Auswirkungen der Querdenken-Bewegung sind inzwischen erforscht: wie Forscher:innen des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim (ZEW) und der Humboldt-Universität zu Berlin Anfang Februar veröffentlichten, hatten die Querdenker-Demos einen erheblichen Anstieg der Inzidenz zur Folge. Heißt im Klartext: Querdenken-Demonstrationen haben Menschen getötet. Die fahrlässige Dummheit der Demonstrierenden ist das eine, das andere die Ohnmacht der staatlichen Gewalt - so hatten einige Gerichte (Judikative) Versammlungsverbote aufgehoben, Ansagen aus den Innenministerien und der Polizei (Exekutive) führten zu unklaren Befehlsketten, sodass schließlich Tausende ungehindert und ohne hinreichenden Infektionsschutz durch die Städte laufen konnten.
"Die Forschenden schätzen, dass bis Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen hätten verhindert werden können, wenn diese beiden großen 'Querdenken'-Kundgebungen abgesagt worden wären" (ebd.). Bei einer Sterberate von ca. 3% heißt das, dass in diesem Zeitraum 480-630 Menschen durch Corona gestorben sind, weil Querdenker auf den Straßen ihre Freiheit gefeiert und anschließend Menschen in Bussen, Bahnen, Supermärkten und zu Hause angesteckt haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es ist ruhiger um euch geworden, vermutlich (und das wünsche ich niemandem!) haben inzwischen viele von euch Angehörige oder Bekannte durch Corona verloren. Statistisch gesehen ist heute in ungefähr jedem achten sozialen Kreis ein Mensch in Deutschland an Covid-19 gestorben**. Bevor sich das Kind nicht selbst die Finger verbrannt hat, erkennt es auch nicht die generelle Gefahr des Feuers.
Corona: Neue Konfliktlinie der Gesellschaft
Corona spaltet die Nation(en). Und teilweise sogar Familien. Ob ich für oder gegen die Corona-Politik bin, kann sogar über meine berufliche Perspektive entscheiden. Wer bei Querdenker-Demos mitlief, wurde teilweise kurz darauf fristlos entlassen; und ich würde sagen, aus gutem Grund. Dass Familienangehörige sich zerstreiten, weil der eine an die Verschwörung glaubt, die andere mit ihren recherchierten Fakten aber auf Granit beißt, ist tragisch. Was das für den Zustand unserer Diskussionskultur aussagt, ist auf gesellschaftlicher Ebene verheerend.
Denn plötzlich ist es egal, was man bei der letzten Wahl angekreuzt hat - Corona ist endlich mal wieder eine neue Konfliktlinie, wie es sonst nur Atomkraft oder Kriege geschafft haben: ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Plötzlich ergeben die altbekannten Kategorien links vs. rechts keinen Sinn mehr. Wenn Hippies, Impfgegner und Neonazis gemeinsam marschieren, lecken sich Sozialwissenschaftler:innen die Finger. Andere machen sich Sorgen, dass das, wovor die selbsternannten Aufgewachten oder Erleuchteten warnen, Wirklichkeit werden kann: eine Diktatur. Die Angst davor wiederum wird nicht selten befeuert durch fiktive (!) Romane wie der von Dirk Rossmann beschworenen Öko-Diktatur (Rezension über "Der neunte Arm des Oktopus" hier). Doch mit Ängsten kann man natürlich gut spielen und Menschen damit manipulieren; das wissen die Drahtzieher hinter Querdenken genauso gut wie Goebbels und Himmler. Besonders perfide: Sie unterstellen ihren Gegnern (der Regierung, dem Robert-Koch-Institut, dem globalen Finanzkapital und Bill Gates...) exakt ihre eigene Startegie. Das ist praktisch, denn so muss man sich keine Verschwörung überlegen. Angela Merkel und Jens Spahn seien also durch und durch böse, verbreiteten Lügen, um ... ja, um was eigentlich genau? Jedenfalls ist das alles falsch, glaubt man den Querdenkern. Mit diesem Narrativ bringen sie auf bizarre Art und Weise Menschen dazu, hinter der Bundesregierung und dem Staat an sich eine totalitäre Elite zu vermuten, welche wiederum eigentlich Drahtzieher der Querdenken-Bewegung sind. Genial und furchtbar zugleich.
Wer sich die Mühe macht und dem Gesetzgeber wirklich auf die Finger schaut, weiß, dass sowohl die Bundes- und Landesregierungen als auch die Parlamente selbst die größten Schwierigkeiten hatten mit den weitreichenden, oft sehr kurzfristig und teilweise nicht durch Abgeordnete ratizifierten Maßnahmen. Aber das ist es, was der Souverän im Krisenfall tut: er entscheidet, weil die Gefahr für seine Bürger:innen größer ist als deren Ermessens- und Handlungsspielraum. Als in den 1962 Jahren die große Sturmflut vor allem die Menschen in Hamburg unmittelbar bedrohte, hat wohl niemand Demonstrationen gegen die Flut, gegen Fake News über eine erfundene Bedrohung durch Sturm und Wassermassen bis in die erste Etage organisiert. Helmut Schmidt hat damals weitgehend durchregiert. Und das hat vielen Menschen das Leben gerettet, wenn auch nicht allen. Ich habe die Sturmflut selbst nicht miterlebt, doch ich frage mich wirklich, ob es uns heute einfach zu gut geht?
Nun kann man eine Flut besser einschätzen als ein Virus. Wir Menschen sind da etwas beschränkt, immerhin können wir Viren sinnlich nicht wahrnehmen - sie sind einfach zu klein. Bevor es so etwas wie Zivilisation gab, hat sich darüber hinaus niemand geschert, wenn Viren die Runde machten: wir saßen weniger kompakt aufeinander als heute, konnten den Viren damit weniger attraktive Fläche zum Austoben geben und ob Onkel Otto nun an einem Urvater von Sars, Malaria, Hunger oder einem Säbelzahntigerangriff starb, was für die Statistik am Ende auch egal. Deutlich war, dass diejenigen in Ottos Stamm, die sich von den Gefahrenquellen ferngehalten haben, überlebt haben. Die natürliche Auslese haben wir durch moderne Gesellschaftsverträge jedoch (zum Glück!) ausgehebelt. Viele Querdenker wissen vermutlich nichts vom Erbe der Aufklärung oder den ziemlich stabilen Institutionen der Gewaltenteilung, und sie wissen ihre Privilegien in einem reichen Land wie Deutschland nicht zu schätrzen. Sie denken lieber an kurzfristige Glückshormone denn ans große Ganze. Erstaunlich, dass wir es als sprechende Affen soweit bringen konnten.
Wie wird der Corona-Sommer 2021: Zurück zu Normal? Nie wieder.
Machen wir uns nichts vor: Die Pandemie hat uns einen Spiegel vorgehalten. Einige haben sie zu Aufopferung, Selbstquarantäne, Doppelbelastung geführt. Andere haben ihr wahres, demokratie- und wissenschaftsfeindliches Gesicht gezeigt. Und wie geht es jetzt weiter?
Viele fordern ein Zurück zu Normal. Doch das wird es nicht geben. Die Pandemie hat nicht nur die ganze Menschheit in eine kollektive Krisenerfahrung gestürzt, sondern auch das Versagen einiger Gesellschaftsbereiche offenbart. Trotz der Warnungen diverser Kommissionen und Risikoberichte waren die wenigsten Staaten hinreichend vorbereitet - wir dürfen nur hoffen, dass wir daraus lernen. Denn diese Pandemie wird nicht die letzte gewesen sein. Zwar haben hochrangige Funktionäre der Weltgesundheitsorganisation WHO angedeutet, dass der Scheitelpunkt der Pandemie bereits erreicht sein könnte, doch darauf würde ich noch nicht wetten. Bleiben wir eher beim durchschnittlich wahrscheinlichen Szenario, dass sich das Virus und seine Mutanten noch für etwa ein Jahr erfolgreich reproduzieren können (ich hoffe, ich liege falsch).
In der naheliegenden Zukunft, also im Jahr 2021 heißt das folgendes:
- das Impfgeschehen wird zwar voranschreiten, doch halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass das Versprechen der Kanzlerin eingehalten werden kann. Eine Woche vor der Bundestagswahl soll idealerweise Herdenimmunität erreicht sein; überambitioniert, wenn Sie mich fragen.
- die Verteilung des Impfstoffs, und das ist gute und schlechte Nachricht zugleich, muss weltweit vorangetrieben werden. Der Teil der Geschichte fehlt im Großteil der Medienberichterstattung: wir sind nicht nur, aber auch deshalb so langsam, weil die Bundesregierung zumindest ein bisschen solidarisch handelt. Insbesondere die Unterstützung von Covax, dem Bündnis des globalen Nordens für die Unterstützung des globalen Südens in der Bereitstellung der Impfstoffe, dürfte noch zu einigen Nominierungen für Friedensnobelpreise führen.
- der Klimawandel ist nicht verschwunden - zwar gingen die CO2-Emissionen 2020 leicht zurück, jedoch sinkt dadurch natürlich nicht die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Die Polkappen und Permafrost in Grönland oder Sibirien ziehen sich weiter zurück, dadurch wird weniger Sonnenlicht reflektiert, der Klimawandel beschleunigt sich weiterhin. Nicht zuletzt durch den Wiedereintritt der USA zum Pariser Klimaabkommen ist die globale Marschrichtung klar: es wird mehr getan werden, um Emissionen zu reduzieren und alternative, umweltfreundlichere Wege zu finden, um unseren Lebensstandard aufrecht zu erhalten und den des globalen Südens anzugleichen. Keine leichte Übung. Konkret bedeutet das für den Sommer 2021: freuen Sie sich nicht zu früh, wenn Buchungsportale und Schnäppchenangebote zu (Fern-)Reisen locken wollen. Lesen Sie genau die Stornobedingungen, denn die Reisebschränkungen können und werden sich über Nacht ändern. Nicht gerade zugunsten der Reiselust. Viele erwarten nach dem kalten Winter einen sehr warmen Sommer - Urlaub würde ich nur im eigenen Bundesland planen, wenn überhaupt. Die großen Tourismusanbieter planen derweil auf Sparflamme, erwarten kein Zurück zu Normal, sondern dauerhaft geringere Reiseaufkommen - wer den längsten Atem hat, wird in zwei bis drei Jahren noch Reisen anbieten.
- die Innenstädte darben nach Wiederöffnung der Geschäfte. Die Staatshilfen konnten viele auch kleinere Ladeninhaber:innen bisher über Wasser halten, doch sie brauchen den Zustrom der Massen; die erhöhten Versandquoten retten höchstens eine schwarze Null. Es nützt nichts. Ich erwarte einen großen Ansturm auf alles, was in den letzten harten Lockdown-Wochen und -Monaten verboten war. Daraufhin wird die Inzidenz besonders mit den neuen Covid-Varianten nach oben schnellen und noch bevor Dr. Drosten und das RKI "Inzidenzwert über 150!" aussprechen können, ist es zu spät: die exponentielle Steigerung ist dann für ein paar weitere Wochen vorgezeichnet, wir müssen wieder schließen, auch Grenzen. Ja, die lahmarschige Bürokratie im Gesundheitswesen trägt eine Teilschuld daran - vor allem aber die Sturheit der Menschen.
- es wird eine teilweise Belebung des Veranstaltungssektors geben. Soweit zur guten Nachricht, die schlechte folgt sogleich: Eintritt nur mit (EU-)Impfpass oder tagesaktuellem, negativem Testergebnis. Aus meiner Sicht ein fairer Deal im Sinne der Gemeinschaft, für viele eine Zumutung. Viele Event-Agenturen, Produktionsfirmen, Messen oder Festival-Veranstalter sind jedoch vorsichtig und möchten nicht das Planungschaos von letztem Jahr wiederholen (warten Sie auch noch auf Erstattungen einiger Konzerte?) - daher wird das Angebot extrem beschränkt sein, die Platzanzahl begrenzt, die Preise höher - denn die Künstler:innen, Dirigent:innen und Produktionsangestellten verlangen zu Recht denselben Lohn, der sich dann aber auf weniger zahlende Gäste aufteilen muss. Eine neue Form der solidarischen Kulturszene muss sich von unten entwickeln, das heißt: auch durch Sie. Dazu gehört auch die gezielte Unterstützung von Initiativen, die Kulturschaffenden durch die Krise helfen, aber auch neue Erlösmodelle für alle Seiten - denn das wird durch die staatlichen Hilfen leider besonders vernachlässigt.
- freuen Sie sich auch nicht zu früh über Schulöffnungen. Ich schätze, dass es spätestens im Herbst zu einer gewaltigen Eruption im Schul-, Universitäts- und Ausbildungsbereich kommen wird. Es ist eine Schande für dieses Land, dass etwa ein Jahr nach Beginn der Pandemie noch immer keine vernünftigen Konzepte für Remote / Home Schooling vorliegen, Gesetzgeber, Schulleitungen und Lehrkräfte bekleckern sich mit allem, nur nicht mit Ruhm. Die über Jahrzehnte sträflich vernachlässigte Unter-Förderung von Lehrkräften, die Konservierung alter Werte statt "neuer" Erkenntnisse der Bildungsforschung, die kategorische Ablehnung digitalisierter Lernmethoden und -inhalte (Stichwort Medienbildung, Informatik als Pflichtfach...) könnten zu dem größten Bildungsvakuum seit dem zweiten Weltkrieg beitragen.
- eine wesentliche Ursache des Aufkommens und der Verbreitung von Pandemien sind Bewegungsmuster und Klimarahmenbedingungen. Je mehr Kontakte zwischen den Wirten, desto besser fürs Virus. Je wärmer und feuchter, umso wohler fühlen sich Viren. Beide Bedingungen unterstützt die globalisierte und ökologische Faktoren ignorierende Gier der Menschheit. Die derzeitige Form des Kapitalismus, der Mobilität, der Energiewirtschaft hat uns geradewegs in die Pandemie geführt. Davor habe ich (und viele andere) gewarnt, doch letztlich ist business-as-usual einfacher als eine ernsthafte Reflexion oder gar die Absicht, grundlegende Dinge zu ändern.
Klingt ziemlich düster, ist es auch. Aber es lässt gerade noch ein bisschen Luft für Optimismus, denn genau jetzt ist noch Zeit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Es ist die Zeit, gescheiterte Konzepte gnadenlos an den Pranger zu stellen und die Zeit bis zu den Bundestagswahlen zu nutzen, die Programme aller Parteien zu prüfen. Fragen, die ich mir dabei stelle:
- Wer setzt sich für eine fundamentale Neuausrichtung des Bildungssektors ein?
- Wer hat den besten, realistischen Plan für die Erreichung der Klimaziele?
- Wer schaut über den Tellerrand der nächsten Legislatur und behandelt die Themen, die bis 2050 wichtig werden, und richtet darauf das Programm aus?
- Wer denkt auch in dieser Pandemie, die uns noch ein paar Jahre beschäftigen wird, nicht nur an die Lobby, die gerade am lautesten schreit, sondern bündelt Maßnahmen, die für alle funktionieren?
- Gibt es überhaupt eine etablierte Partei, die nicht in der traditionellen Machtallokation gefangen ist, sondern wirklich nach Werten und Zielen handelt?
- Wagt eine Partei mehr Demokratie an den Stellen, wo sie sinnvoll ist?
Noch eine Pandemie in diesem Ausmaß können wir uns alle nicht leisten. Nutzen Sie Ihre Stimme weise.
____________________________________________________________________
* das gilt vor allem für die Unionsparteien CDU und CSU. Bei der AfD knickt das Wähleralter ab 70 wieder ein - denn die können sich noch daran erinnern, was die Vorgängerpartei (NSDAP) durch ihr Programm mit ihnen oder ihren engsten Angehörigen angerichtet haben.
** Die Formel dafür lautet: 82.000.000/68.000/150. 82.000.000 Menschen leben gerundet in Deutschland, 68.000 sind (abgerundet) bis zum heutigen Tag laut Statista an Covid-19 gestorben, 150 ist die ungefähre Größe eines sozialen Umfelds, also die Anzahl der Menschen, die Sie persönlich gut kennen. Das ist an vielen Ecken sehr unsauber gerechnet, aber ich bin Sozialwissenschaftler, kein Mathematiker, Virologe oder ähnliches. Was die Modellrechnung verdeutlicht: Menschen müssen (wie kleine Kinder) erst merken, dass es wehtut, bevor sie etwas verstehen. Querdenker sind die Kinder der Nation, könnte man sagen.
- Die Grafik ("I want to believe") liegt unter der Creative Commons Lizenz vor: Splendora93, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
- Beitragsbild: Photo by Hannah Morgan on Unsplash










